Ich bin depressiv seit ich 13 bin, davor habe ich mich auch schon mies gefühlt. Ich habe das mein Leben lang.
Eva dachte, sie wüsste, was ihre Depression bedeutet…
…bis ihre Psychiaterin sie 2015 in eine Psychoedukations-Gruppe schickt. Dort wird Wissen über die verschiedenen Facetten der Krankheit vermittelt. Evas erste Reaktion: „Lass mich in Ruhe.“ Trotzdem sitzt sie wenig später in besagter Gruppe. „Das war für mich ein Augenöffner“, sieht sie jetzt. Sie lernt ihre Depression von ihrer Persönlichkeit zu separieren. „Es ist einfach eine Erkrankung in mir. Das hat nichts mit meinem Charakter zu tun.“ Eva kann auf über zehn Jahre „Depri-Karriere“, wie sie selbst ihre Erkrankung bezeichnet, zurückblicken. „Ich war schon immer so ein bisschen schräg“, erzählt sie nüchtern. Auf dem Land in einem kleinen Dorf war es für Eva nicht immer einfach Freunde zu finden. Deshalb hat sie sich schon früh ins Internet verkrochen. Heute lebt die 30-Jährige in Wiesbaden. Sie beschreibt ihr Umfeld als mental sehr gesund. In einer Down-Phase fasst sie den Entschluss, mit anderen zu teilen, wie es ist mit einer Depression zu leben. Eva will zeigen:
Das muss nicht immer nur traurig und schwarz-weiß sein, sondern man kann damit auch irgendwie klarkommen.
Unter ihrem alias „Depridisco“ spricht sie seit 2019 auf Instagram zu mehr als 6.600 Follower:innen über ihre psychische Erkrankung.
Depri in der Disco?
Depression und Disco. Außer dem gleichen Anfangsbuchstaben haben diese beiden Begriffe eigentlich nichts gemeinsam. Tatsächlich gehören sie für Eva jetzt irgendwie zusammen. Als sie finanzielle Probleme hat, geht ihr der Spruch „Panic at the Dispo“ nicht mehr aus dem Kopf – eine Umwandlung des Bandnamens „Panic at the Disco“. „Dieses Disco-Ding war dann immer präsent“, erzählt Eva. Auch wenn sie über ihre „Depris“ redet. „Ich wollte keinen Namen, der verspricht, dass ich meine Depressionen überwunden habe, das ist eben nicht so.“ „Katastrophenschutzzentrum“, steht im Steckbrief ihres Accounts.
Für alle, die zu depressiv sind, lange Ratgeber zu lesen oder das Haus zu verlassen.
Die Zeichnung einer schwarzen Maske auf hellrosa Untergrund ziert ihr Profilbild. Sie erinnert an die Maske von Batman. Ein Gesicht dahinter gibt es allerdings nicht. Eva selbst zeigt sich auf ihrem Account nicht. Auch in ihrem Story-Highlight „Über mich“ ist die Suche nach Selfies vergeblich. „Heute ist Maskentag“ verkündet die erste Slide im Highlight „Depri-Alltag“.
Wie fühlt sich eine Depression an?
Eva spricht bisher nur anonym über ihre Erkrankung und auch das kostet sie Überwindung. Die Idee, ihre Erfahrungen mit der Depression zu teilen, entstand bereits 2016. „Das hat dann drei Jahre gedauert, bis ich mich überwunden habe.“ Evas Instagram-Feed besteht nicht aus Selfies, Gruppenfotos oder Landschaftsimpressionen, ihre Beiträge sind bunt geletterte Botschaften und Illustrationen. Ursprünglich wollte die selbstständige Kommunikationsdesignerin ihre Kunst in einem Buch sammeln. Die Entscheidung für Instagram war eine Kurzschlussreaktion. Eine Freundin ermutigte sie, auf der Plattform zu posten:
Schieß da einfach mal was hoch und dann guckst du, was passiert.
Wann Eva etwas „hochschießt“, plant sie bis heute nicht voraus und bei allem gilt: bloß kein Zeitdruck. So kann es auch mal ein halbes Jahr dauern, bis es ein Post aus der virtuellen Schreibtischschublade auf ihren Account schafft. „Meistens fängt es damit an, dass ich einen Gedankenfetzen im Kopf habe, den ich mir in irgendeiner To-Do-Liste aufschreibe. Und irgendwann, vier oder sechs Wochen später, überlege ich, ob ich das mal lettern könnte“, erklärt sie den Kreativprozess.
„Choose happy haben sie gelettert…is klar“, postet Eva im März 2019. Handlettering, wie das Zeichnen und Malen von Schrift genannt wird, werde ihrer Meinung nach oft von Plattitüden vereinnahmt. „Liebe Hobbyletterer“, wendet sie sich in diesem Beitrag an jene, „bitte fühlt euch nicht angegriffen.“ Eva verstehe, was Zitate wie „choose happy“ bedeuten, aber einfach auf „happy“ klicken sei dann doch nicht so einfach. „Wenn die Seele erkrankt ist und nichts positives mehr durchkommt, tut es unglaublich weh, Sätze wie „Einfach mal machen, was soll schon schief gehen?“ oder „choose happy“ und wie sie noch alle heißen, zu lesen“, teilt sie in der Bildunterschrift. Eva nutzt das Handlettering, um ihre Erfahrungen mit der Depression zu transportieren. „Gefühl des Tages: Mein Gehirn ist eine träge Masse“, steht schwarz und dunkelrot auf weißem Hintergrund. Menschen auf diese Art zu sagen „Hey, das bin ich und das gehört auch dazu“ ist für Eva ein hilfreicher Prozess: „Das ist ein Ventil, um mich mit meiner Krankheit auseinanderzusetzen.“
Die Angst vor einem Shitstorm begleitet Eva jedoch immer. „Ich mache mich natürlich komplett nackt. Ich erzähle wirklich sehr intime Sachen. Nicht, was ich gegessen habe, wo ich wohne oder wer mein Partner ist, sondern diese ganzen Seelen-Geschichten.“ Bisher ist ihre Angst jedoch unbegründet. „Das ist dann wahrscheinlich die Psyche, die mit mir ihre Tricks spielt“, reflektiert sie. In ihrem letzten Beitrag zur Angst vor einem Shitstorm, kommt sie zu dem Schluss: „Bin ich zu sensibel? Wahrscheinlich schon.“
Von Selbstzweifeln und Selbsthilfe
Ich habe so ein kleines Impostor-Syndrom
gesteht Eva.
Auch beim Verfassen von Posts plagen die 30-Jährige häufig Selbstzweifel: „Ich denke immer: Das will sowieso niemand haben, da interessiert sich sowieso niemand dafür, außerdem ist es nicht gut genug.“ Eigentlich sieht sie ihren Account selbst auch nicht als „instagrammable“ mit ihren unregelmäßigen Posts. Von einer Influencerin sei sie weit entfernt. „Irgend so eine Tante, die halt Insta macht“, fängt Eva an. „Aber das sagt man nicht“, setzt sie hinterher. Wie Eva es findet, dass über sechseinhalb tausend Menschen ihre Erfahrungen verfolgen? „Das ist schon abgefahren“, sagt sie und lacht. Sie pflegt einen regen Austausch mit ihren Follower:innen und berichtet von vielen „super lieben“ Direktnachrichten: „Ich habe endlich erkannt, was los ist mit mir, weil du das so auf den Punkt bringst“ oder „Ich habe deinen Account meinen Eltern gezeigt, die wissen jetzt endlich Bescheid“. Sie inspiriere auch manche dazu, eine Therapie zu beginnen. „Das ist für mich das Tollste, was passieren kann, wenn ich die Leute dazu inspiriere, sich selbst zu helfen.“
Hilfe zur Selbsthilfe. „Wir müssen selbst erkennen, dass etwas nicht stimmt und das kann eine ganze Weile dauern“, schreibt Eva Ende 2019 in einem Beitrag. Sich selbst beobachten, auf seine Gefühle hören, sich in Achtsamkeit üben.
Selbst wenn man nur damit anfängt, dass man sagt, ich fühle mich irgendwie kribbelig im Bauch oder ich habe irgendwie so eine Schwere auf dem Kopf
rät Eva.
17 Jahre auf Therapiesofas haben ihr geholfen, über ihre Gefühle zu sprechen. Aber sie betont immer wieder, auf welcher Seite des Sofas sie sitzt. Eva ist kein Profi, sie ist auch „nur“ Patientin. Wenn sich Follower:innen eine Beratung von ihr wünschen, kommuniziert sie klare Grenzen. Depridiso ist ein Erfahrungsbericht, keine Therapie.
Psyche für alle?
Psychohygiene ernst nehmen, auch mal eine Therapie machen – das hat nichts mit Schwäche zu tun. „Eine Psyche haben wir alle. Das betrifft uns alle.“ Trotzdem erlebt Hatice Budak als Muslima innerhalb der muslimischen Community eine Tabuisierung von psychischer Gesundheit. Die Deutsch-Türkin möchte zeigen:
Wir dürfen uns diesem Thema auch widmen, ohne Angst davor zu haben, abgestempelt zu werden.
Im Teenageralter hatte Hatice eine prägende Erkenntnis. „Vielleicht sogar die erste, die ich so in meinem Leben hatte“, blickt die 28-Jährige zurück. „Ich habe immer damit zu kämpfen gehabt, dass ich zwischen zwei Welten bin und das Gefühl vermittelt bekommen habe, mich entscheiden zu müssen, ob ich mehr türkisch oder mehr deutsch bin.“ Aus ihrer Identitätskrise, wie Hatice selbst sagt, wird schließlich eine Selbstfindungsphase: „Ich habe irgendwann verstanden, dass beide Anteile sein dürfen, dass das eigentlich eine Superpower ist.“ Anstatt sich für eine Welt zu entscheiden, vereint sie beide Nationalitäten – eine hybride Identität.
Hatice ist klinische Psychologin und in der Ausbildung zur Psychotherapeutin, als sie ihr Identitätspseudonym „Hybridpsychologist“ kreiert. „Du scrollst durch Instagram und siehst ganz viele Bilder, die deine Gedanken in eine ganz bestimmte Richtung lenken oder verzerren können“, meint die Psychologin. Das kann auf die Psyche schlagen. Aufklärung über mentale Gesundheit auf der Ich-teile-mein-Leben-Plattform? „Ich dachte damals tatsächlich, es gibt sowas noch gar nicht“, erzählt sie. Aus dieser Motivation heraus erstellt sie 2019 ihren Account @hybridpsychologist auf Instagram, um für psychische Gesundheit zu sensibilisieren und sich für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen einzusetzen. Schnell findet sie sich in einer doch nicht so kleinen Community von Kolleg:innen wieder. „Ich finde das wirklich super bereichernd, dass man sich auf dieser kollegialen Ebene austauschen kann, mit dem Ziel, das bestmögliche Angebot zu machen.“ Gleichzeitig betont das Story-Highlight „Disclaimer“ auf ihrem Account:
Instagram ersetzt keine Therapie
Hatice weist auf die plattformbedingte Begrenztheit der Darstellung hin. Laut Hatice sei es wichtig, nicht zu fachsimpeln, „sondern die Themen herunterzubrechen“, damit sie auf den Alltag übertragen werden können und zur Selbstreflexion anregen. „Ich bin echt stolz darauf, dass ich diese Fähigkeit habe, abstrakte Dinge aufzuschlüsseln“. So hätte sie sich auch im Studium schon Themen durch Visualisierungen angeeignet.
Jetzt füllen orangefarbige Illustrationen, Zitate und Erklärungen die Kacheln auf ihrem Instagram-Account. „Mehr als nur ein Trendwort“ steht in einem orangenen Banner, darunter: „Was ist eigentlich Selbstfürsorge?“ In eine Decke eingewickelt und mit einer Tasse in den Händen sitzt die Illustration einer Frau auf einem orangen Teppich und lächelt, vor ihr ein aufgeschlagenes Buch. Auf der nächsten Slide sind bekannte Tipps für Selbstfürsorge aufgelistet – „Ist das aber schon Selbstfürsorge?“ Hatice erklärt in dem mehrteiligen Beitrag „Ja, aber… nur ein Bruchteil“. In Serien wie „Essstörungen im Überblick“ oder „Parentifizierung“ beleuchtet Hatice psychische Erkrankungen und liefert Einblicke in die therapeutische Arbeit.
Mittlerweile stützt sie eine Follower:innen-Base von mehr als 16.000 Menschen – „surreal“, findet Hatice. „Irgendwann verliert man auch den Bezug zu Zahlen. Das sprengt einfach meine Vorstellungskraft.“ Als Influencerin sieht „Hati“, wie ihre Follower:innen sie nennen, sich aber nicht. „Dieser Begriff ist so negativ konnotiert“, erklärt sie. „Ich habe mich noch nie aus dieser Perspektive betrachtet, dass ich irgendetwas beeinflusse.“ Hatice fällt es schwer, sich in eine solche Kategorie zu zwängen.
Man macht das ja aus einer Sinnhaftigkeit heraus. Man möchte helfen und möchte Menschen berühren. Man möchte Menschen unterstützen.
Wieder trudelt eine Direktnachricht bei Hatice ein. Eine Sprachnachricht, in der sich eine Followerin den Kummer von der Seele spricht. Ganz privat, ganz persönlich. „Ich war schon immer eine ganz gute Zuhörerin“, meint Hatice und lacht. Anfangs versuchte sie noch, auf alles einzugehen. Mittlerweile hat sie gelernt, dass Instagram nicht die richtige Plattform für diese Art der Unterstützung ist – zu antworten versucht sie dennoch. Sie verweist auch auf ihre Online-Beratung oder schlägt vor, sich an einen Therapeuten zu wenden. Negative Erfahrungen mit Follower:innen hatte Hatice bisher kaum. „Die haben sich dann auch sehr schnell zu positiven Erfahrungen entwickelt“, wenn sie auf die Person zugeht und nachfragt. Falls sie einen Kommentar unter einem ihrer Beiträge löscht, schreibt sie dem Verfasser privat und erklärt ihr Vorgehen. „Dann fühlen sich die Menschen oftmals auch sehr verstanden oder sind überrascht, mit welcher Wertschätzung man an sie herantritt.“ Hatice sei es wichtig, jeglichen Meinungen Platz zu bieten, solange sie im Rahmen des Respekts und der gegenseitigen Wertschätzung bleiben würden.
Ich habe das Bedürfnis, allen Menschen eine Plattform zu geben, einen sicheren Raum zu geben, wo sie sein dürfen, wo ihre Gefühle sein dürfen und wo sie sich nicht verstecken müssen.
Ist Therapie instagrammable?
Instagram ist keine Therapie, der Algorithmus keine Diagnose, die Kommentarfunktion kein Therapeut. Dennoch kann Social Media erste Berührungspunkte mit dem Thema psychische Gesundheit herstellen und Accounts wie @hybridpsychologist oder @depridisco bieten ein niederschwelliges Angebot, um für psychische Erkrankungen zu sensibilisieren. Hatice und Eva können über Instagram viele Menschen erreichen und dazu beitragen, das Thema Mental Health in der Gesellschaft sichtbarer zu machen. Im realen Leben braucht es viel Mut, um zum Telefon zu greifen und einen Termin bei einem Therapeuten zu vereinbaren. Weitaus leichter fällt es, beim täglichen Scrollen durch Instagram den „Abonnieren“-Button einer Psychologin wie Hatice zu drücken oder sich durch eine Direktnachricht an Eva als Betroffene Rat zu holen. Die Hemmschwelle ist wesentlich niedriger. Wenn man sieht, wie Follower:innen in den Kommentaren unter Beiträgen ihre eigenen Geschichten teilen, kommt es zu einer wichtigen Erkenntnis: Du bist nicht allein. Eva hilft mit ihrem Erfahrungsbericht nicht nur anderen, sie hilft auch sich selbst: „Mir hilft das auch, zu merken, dass ich nicht alleine damit bin und dass irgendwie fünf Millionen Leute in Deutschland davon betroffen sind und ein paar davon mit mir reden.“ Der Austausch in den Kommentaren kann sehr wertvoll sein, wenn sich Betroffene gegenseitig unterstützen. Allerdings geht mit dieser gesunkenen Hemmschwelle auch oft eine ungeschützte Offenheit mit der eigenen Geschichte einher, die bei dem sensiblen Thema psychische Gesundheit durchaus kritisch zu betrachten ist.
Zwischen Therapisierung und Instagrammisierung
Julia Neumann ist klinische Psychologin und Gesundheits-Psychologin und Psychotherapeutin mit Fachrichtung Hypnosepsychotherapie. Sie sieht dieses „Entblößen im öffentlichen Raum“ kritisch, wenn teils intime Details preisgegeben werden, ohne dass die Menschen im Format von Instagram die Risiken mitdenken. Noch kritischer wird es, wenn Therapeut:innen-Accounts Persönliches von sich posten. Neumann warnt vor einem leichtfertigen Umgang mit privaten Details im Social Media-Setting. Stalking und Übergriffe auf Therapeut:innen können durch bedenkenloses Teilen von persönlichen Informationen begünstigt werden. „Ich stelle es mir immer so vor“, erklärt Neumann. „Ich gehe auch nicht in meine Praxis und zeige meinen Klienten meine Urlaubsfotos. Warum zeige ich sie dann in Social Media?“ Hier verschwimmen die Grenzen. Neumann selbst hatte nicht einmal einen privaten Instagram-Account, bis sie sich vor zwei Jahren die Frage stellte:
Kann man als Therapeutin seriös auf so einem Kanal agieren?
…und ein Selbstexperiment startete. Hinter ihrem Account @praxis.julia.neumann steckt seit 2019 die Motivation „Geht das?“: „Bei mir ist es immer so, wenn ich etwas herausfinden will, dann muss ich das machen.“ Mit ihren informativen Beiträgen spricht Neumann insbesondere junge Therapeut:innen an, gibt Tipps im Umgang mit Klient:innen, klärt Vorurteile und beantwortet Fragen. Unter ihren gut 4.700 Abonnent:innen befinden sich aber nicht nur Kolleg:innen. Ihre Einblicke in die Psychotherapie haben etwas Geheimes an sich, es ist so „als würde man so ein bisschen in die Köpfe von Therapeuten hineinblicken“, erklärt sie andere Interessierte. Dabei ist ihr Ziel eigentlich nicht, neue Klient:innen über diesen Kanal zu gewinnen. Im Gegenteil könnte ein Follower auf diesem Weg bereits mit einer voreingenommenen Meinung in die Therapie kommen. Das ist per se nicht gut oder schlecht, sondern bedarf lediglich eines anderen Umgangs. Neumann appelliert, diese ersten Berührungspunkte durch Social Media zu thematisieren und im Erstgespräch zu fragen, wie der Account und die Beiträge aufgefasst wurden, welche Erwartungen an die Therapie gestellt werden und auch wie sie als Therapeutin wahrgenommen wurde. Besonders vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Distanz zu wahren und eine professionelle Ebene auch auf Instagram beizubehalten.
In ihrem Beitrag „Können wir per Du sein?“ geht Neumann auf mögliche Probleme des Duzens in der Therapie ein. In ihrer Praxis ist die Therapeutin per Sie. Also eigentlich auch auf Instagram – oder? Dort wird Neumann allerdings in Kommentaren oder Direktnachrichten häufig automatisch geduzt. Die Praxisschwelle wird auf Instagram schnell, leicht und unbedacht überschritten, weshalb Neumann immer versucht zurückhaltend zu bleiben. „Ich versuche, die Emotionen sehr zurückzunehmen und das so zu handhaben, wie ich es auch in der Praxis mache, dass ich das nicht persönlich nehme.“ Wenn sich jemand über ihre Beiträge ärgert, liege das ja nicht an ihr, sondern daran, dass es etwas in der Person ausgelöst hat. Auch bei seltenen angreifenden Kommentaren, sagt sie sich selbst: „Du bist trotzdem als Therapeutin hier, nicht als Privatperson.“
Ihr Gegenüber sieht Neumann immer durch die Therapeutinnen-Brille und kommuniziert auch auf Instagram wie mit einem Klienten. „Ich empfinde es als sehr wichtig, dass ich dort nicht diskutiere. Ich sage schon mal meine Meinung, aber ich versuche es immer so zu sagen, als würde ich es Klienten sagen.“ Und die sind nun mal individuell. „Es kann, es könnte, es muss nichts.“ Neumann spricht auf ihrem Account nicht in Absolutismen.
Es ist mehr wie ein Angebot, man kann sich da was rausnehmen oder nicht.
Keinen zurechtweisen, niemanden bevormunden, nicht zwischen richtig und falsch urteilen – eine Devise, die den professionellen Kontext auf Instagram wahren soll.
Eine Strategie, die jedoch eigentlich gegen die Natur des Mediums strebt. „Diese Social-Media-Regeln sagen halt was anderes. Die sagen: Zeig dich als Person, zeig dich ganz privat, gib ganz viel von dir preis und du musst plastisch sein und du musst für alle irgendwie sichtbar sein.“ Laut Neumann ist ein Auftritt auf Social Media mit dem Beruf des Therapeuten nur dann vereinbar, wenn man diese Prinzipien nicht eins zu eins befolgt. Die Profession sollte immer über der Follower:innen-Generierung stehen und stets der Maßstab für das Verfassen von Posts sein. „Ich poste nicht irgendwas, nur damit ich etwas poste. Ich poste wirklich immer erst dann, wenn ich einen Beitrag habe, der von Herzen kommt oder wo ich wirklich finde, da habe ich jetzt was zu sagen.“ Neumann versucht dabei, ein Thema aus mehreren Perspektiven zu beleuchten, da ihre Posts alle möglichen Involvierten erreichen können. Bei manchen Kolleg:innen fehle aber der ein oder andere Blickwinkel eines Krankheit-Komplexes, weil Eigen-Themen zu stark dominieren. „Da sind manchmal Ratschläge dabei, die ich teilweise sehr platt finde und sehr unwissenschaftlich, sehr unfachlich, wo ein bisschen die persönliche Erfahrung und die persönliche Note durchkommen und nicht mehr die therapeutische.“ In der Praxis treffe man auf alle Klient:innen. Wenn Therapeut:innen eher mit der einen Seite sympathisieren, fühlen sich viele möglicherweise vor den Kopf gestoßen. Das sei aber manchmal „nicht bewusst, nicht böswillig oder absichtlich, sondern es ist einfach nicht präsent, es ist nicht durchdacht, wie das wirkt oder was das auslösen kann.“ Auch Hatice findet es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass gewisse Themen Potenzial haben, Traumata zu triggern.
Problematisch wird es, wenn Menschen aus dem Leid Betroffener Profit schlagen wollen. Auf Instagram werden keine Nachweise über abgeschlossene Ausbildungen verlangt. Jeder kann in seiner Profilbeschreibung angeben, was er möchte – ohne dass damit automatisch die entsprechenden Qualifikationen verbunden sind. Psychologe, Psychiater oder Psychotherapeut. Der Begriffe-Dschungel trägt für Laien nicht gerade zu einem besseren Durchblick bei.
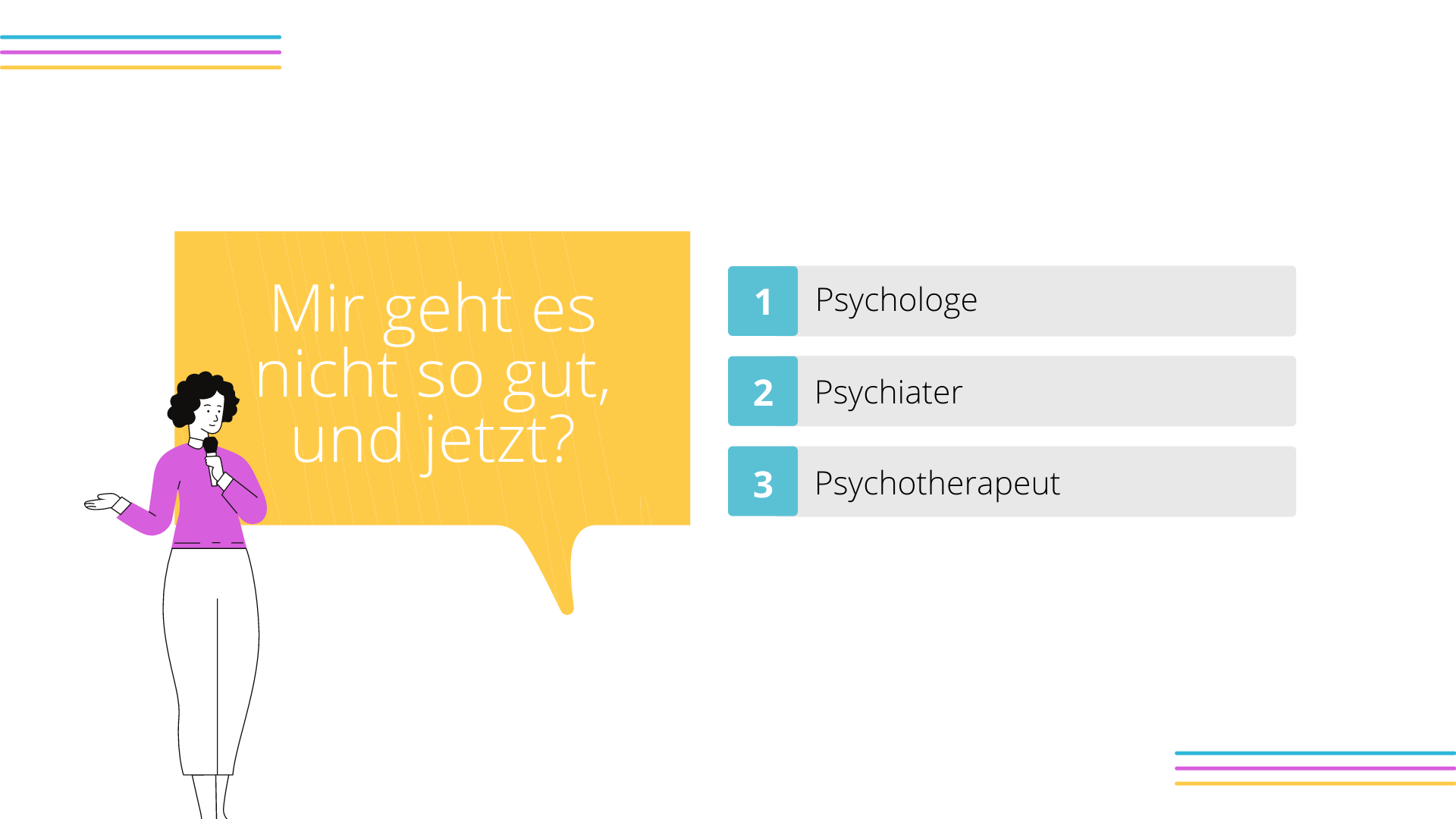
Hinzu kommen einige ungeschützte Berufsbezeichnungen:
Jeder kann sich Trauma-Therapeut nennen oder auch etwas in der Richtung anbieten
gibt Hatice ein Beispiel
Dabei sei das die Königsdisziplin der Psychotherapie. Laut Neumann gehe das bis in den illegalen Bereich. Sie ist schon auf Accounts gestoßen, die Training für Angst-Problematiken anboten, ohne jegliche Qualifikationen vorzuweisen. „In Österreich zum Beispiel ist es nur bestimmten Berufsgruppen vorbehalten, mit psychischen Störungen zu arbeiten. Solche Beispiele von Ängsten gehen ganz klar in diese Richtung.“ Für Laien ist es in den sozialen Medien schwer nachvollziehbar, wer qualitativ hochwertige Inhalte liefert. „Und noch schwieriger ist es natürlich, wenn jemand als Fachpersonal auftritt. Dann hat die Meinung viel mehr Gewicht“, gibt Neumann zu Bedenken. „Wenn man betroffen ist und gerade das Leid so akut ist, da nimmt man halt das, was gerade kommt“, zeigt Hatice die Tragweite von falschen Therapie-Angeboten. Auf den Schultern bzw. den Feed-Beiträgen der Psycholog:innen und Therapeut:innen auf Instagram lastet viel Verantwortung. Man muss wissen, zu welchen Bereichen man als Therapeut die passende Expertise mitbringt und zu welchen Bereichen nicht. Andernfalls trägt man selbst zur Stigmatisierung bei. Hatice beteuert:
Es dient dem Schutz der Betroffenen, dass man seine Grenzen kennt.
Grenzen sind auch für das eigene Seelenleben wichtig. Wenn das Private und das Berufliche aber zusammenlaufen, wird Hatice oft nur noch als Psychologin wahrgenommen. „Aber du bist natürlich weit mehr als das. Das ist dein Beruf und das ist natürlich auch deine Berufung.“ Hatice muss ihr Umfeld manchmal daran erinnern, dass sie trotzdem auch nur ein Mensch ist. Sie kann auch wütend und traurig sein oder eine Auszeit brauchen. „Letzten Endes bin ich immer noch Hati. Und das ist okay. Und das darf ich sein.“ Auch sie braucht Zeit für Selbstfürsorge und Psychohygiene.
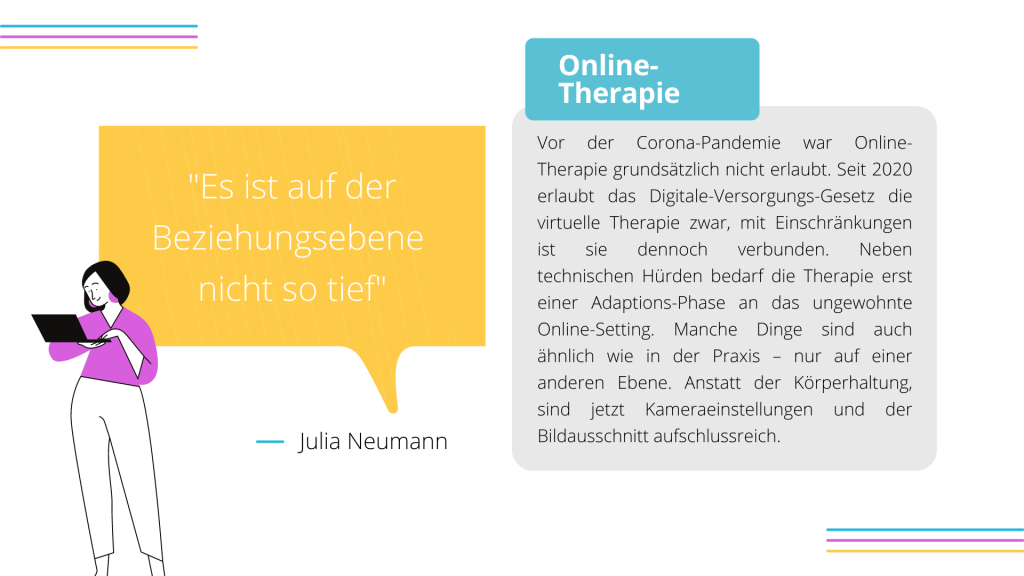
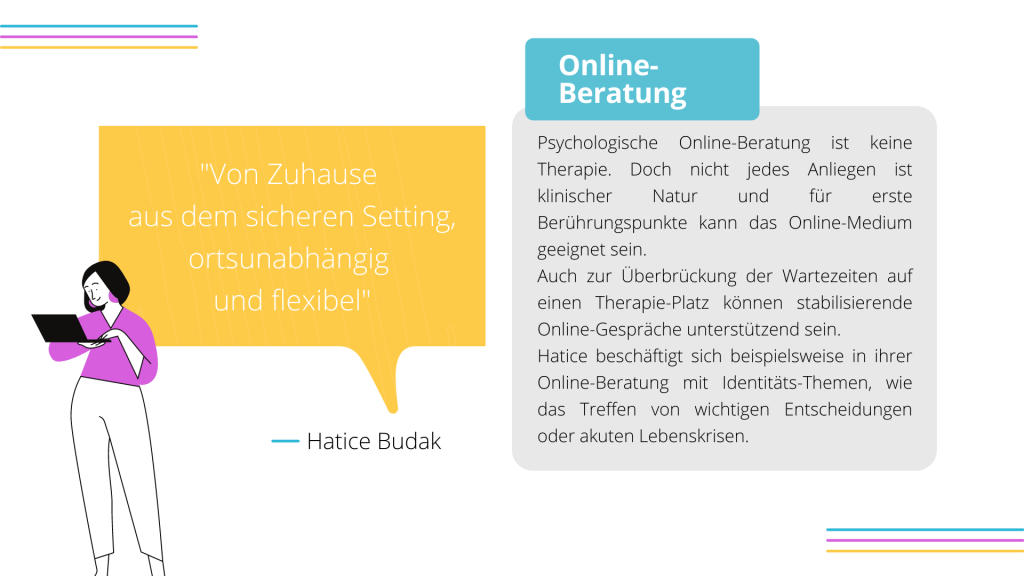
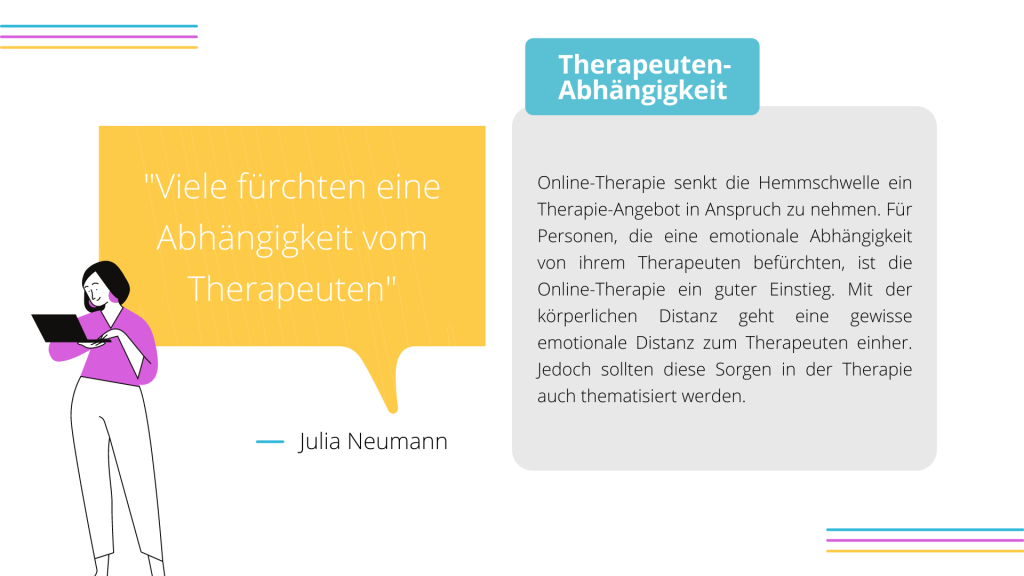
Selbstexperiment geglückt?
Also: „Geht das?“ Kann man als Therapeut oder Psychologe Instagram nutzen? Hatice Budak ist überzeugt: „Ich finde es Wahnsinn, dass man eine Beziehung über dieses Medium etablieren kann. Ich hatte auch meine Vorbehalte, aber die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, sind einfach Wahnsinn und haben meine eigenen Vorurteile auch widerlegt.“ Nach zwei Jahren ihres Selbstexperiments zieht auch Julia Neumann Bilanz: „Mein Fazit ist auf jeden Fall, dass es besser geht, als ich gedacht habe, dass es besser vereinbar ist, als ich gedacht habe. Es gibt aber doch mehr Wechselwirkungen in die Praxis hinein, als ich dachte.“ Im Social Media-Bereich muss man sich ständig anpassen. „Wenn man sich aus meiner Sicht dazu entscheidet, so einen professionellen Account zu machen, wo man auch mit seiner Website und seiner Praxis sichtbar ist, dann muss man sich immer reflektieren.“ Das kann auch anstrengend sein. Für Neumann ist noch nicht klar, ob sie ihren Account für immer führen möchte, aber „jetzt derweil passt es“. Ihr Selbstexperiment läuft weiter.
Selbst-Für-Sorge
Das Selbst. Selbstdarstellung, Selbstwert, Selbstwahrnehmung. Instagram lebt vom Selbst. Dabei geht es um das Selbst nach außen. Hatice appelliert an das innere Selbst: „Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, dass wir uns selbst auch mal ins Rampenlicht rücken und auf uns selbst blicken, weil wir oft einfach mit dem Blick woanders sind.“ Der Blick streift durch neue Beiträge auf dem Insta-Feed. Im Rampenlicht stehen Selbstvergleiche und Selbstzweifel anstelle von Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Botschaften in bunten Lettern und aufklärende Beiträge zeigen jedoch, dass die kleinen quadratischen Kacheln auf Instagram den Blick auch nach innen leiten können. Aus Evas Selbstzweifeln entstand ein anderes Selbstverständnis. „Die große Chance ist das, was mir passiert ist. Ich habe ein ganz tolles Netzwerk gefunden.“ Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis. Seiner mentalen Gesundheit die Priorität beimessen, die man vielen anderen Dingen zukommen lässt. Oder Instagram einfach mal schließen. Sorge für das Selbst.
Kaffee, Bücher, Psyche
Wer sich in der realen Welt mal eine Auszeit für das Selbst nehmen will, der kann sich bei einer Tasse Kaffee in Selbstfürsorge üben. Eine ideale Anlaufstelle dafür ist in München das Café von Kitchen2Soul…
…und wer gerade nicht in München und Umgebung ist, der kann sich die Zeit mit dieser Podcast-Folge von Nahaufnahme vertreiben und dem Gespräch mit Tatjana Reichhart, eine der Gründerinnen des Kitchen2Soul, lauschen.
Essen für die Seele





![[Un]nahbar [Un]nahbar](https://wp.zim.uni-passau.de/unnahbar/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/Schriftzug_JMC-2021.png)
![Wenn Instagram [auf] Psyche trifft Wenn Instagram [auf] Psyche trifft](https://wp.zim.uni-passau.de/unnahbar/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/Beitragsbild-Option-D-1400x788.png)






