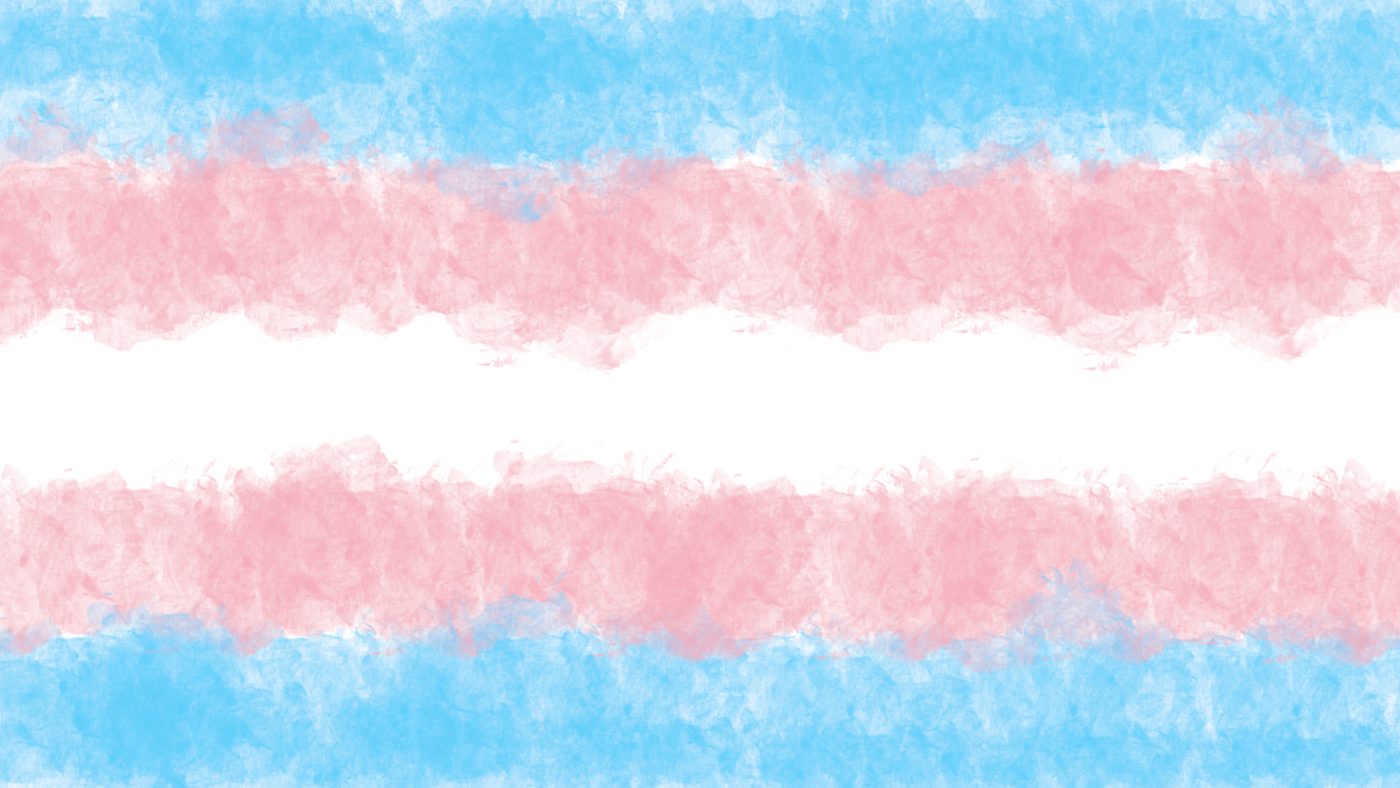Transpersonen werden in Deutschland von Gesellschaft und Rechtslage immer noch pathologisiert und in eine Schublade mit psychischen Erkrankungen oder Pädophilie gesteckt. Wenn der Juni dem Juli weicht und der Pride-Month zu Ende geht, verschwinden die Regenbögen aus den Logos von Großkonzernen – und das Bewusstsein für die Diskriminierung der LSBTI-Community (Lesbisch, Schwul, Bi-, Trans- und Intersexuell) aus den Köpfen der Gesellschaft. Doch der Kampf für die eigenen Rechte geht weiter – und ist angesichts der nahenden Wahlen vielleicht wichtiger als je zuvor.
Der erste Therapeut sieht sie aus randlosen Brillengläsern ernst an und will ihr eine Konversionstherapie aufschwatzen. Die beiden sitzen sich zum allerersten Mal gegenüber, in zwei bequemen, aufeinander ausgerichteten Sesseln in der Mitte des Raumes. Sicher, die Transidentität sei vorhanden, aber als Frau werde sie auch nicht glücklicher als jetzt sein. Wozu also der Stress?
Freundlich verweist er darauf, dass er ihr ein, zwei Adressen, an denen sie Hilfe erhält, nennen könne. Sie sieht aus dem Fenster neben dem Schreibtisch, sieht auf die Wiese vor dem Haus und fragt sich, ob das hier das Wahre ist. So oder so ähnlich hat sich die Szene wohl abgespielt, allzu genau will Theresia Stahl im Interview nicht werden. Die 23-Jährige hat sich vor drei Jahren als trans geoutet. Das bedeutet, sie kann sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren, möchte in der sozialen Rolle (Gender) einer Frau leben. „Ich wusste schon mit 10 Jahren, dass ich lieber ein Mädchen sein will.“

Seitdem ist viel passiert: Sie beginnt eine Hormonersatztherapie, ändert ihren Namen – zunächst inoffiziell – und begibt sich in therapeutische Behandlung. Die ist in Deutschland im Jahr 2021 immer noch Voraussetzung, um eine Personenstandsänderung, also eine Änderung des Namens und Geschlechts im Personenstandsregister, vorzunehmen. Zudem spart sie viel Geld an, um die Kosten für das Verfahren der Personenstandsänderung stemmen zu können. Etliche Gutachten, Gerichtsverfahren, Therapeuten und einen Antrag auf Prozesskostenhilfe später ist es geschafft: Der Name im Personalausweis lautet nun offiziell Theresia Stahl. Einige Dokumente mit ihrem Deadname hat sie aber noch: „Ich war bis heute zu faul, meinen Führerschein umschreiben zu lassen“. Benannt hat sie sich übrigens nach ihrer Patentante: „Ich fand es immer unfair, dass mein kleiner Bruder mit Zweitnamen so heißt wie sein Patenonkel, aber ich nicht so wie meine Patentante“.
Idiotentest, Bausteine und Fetischfragen
Die Erlebnisse in der ersten Therapie sind bei weitem keine Seltenheit. Noch immer wird Transidentität als psychische Störung klassifiziert. Überhaupt ist die begriffliche Abgrenzung verschwommen. Im aktuellen Katalog der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Klassifizierung von Krankheiten, dem ICD-10, steht sie im Kapitel 5, Psychische und Verhaltensstörung. Theresia erhält aber nicht die Diagnose Transidentität. Stattdessen lautet ihre Diagnose: F64 – Transsexualismus. Dabei hat die Frage nach dem sozialen Geschlecht überhaupt nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun.

Foto: UKM
Professor Dr. Georg Romer ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am Uniklinikum Münster. Wenn er transidente Patient:innen behandelt, diagnostiziert er häufig eine Geschlechtsdysphorie. Bereits 2018 haben sich über 20 verschiedene medizinische Fachgesellschaften zusammengeschlossen, um Behandlungsrichtlinien nach dem aktuellen Stand der Medizin zu formulieren. Seitdem wird der Begriff des Transsexualismus in der Fachwelt nicht mehr verwendet. „Wenn es beschlossene Sache ist, dass das Konzept Transsexualismus obsolet ist, dann ist es obsolet, und zwar ab sofort.“
Als Übergangskompromiss wird also in der Fachwelt von Geschlechtsdysphorie gesprochen, während weiterhin die Codierung F64, also Transsexualismus, angegeben werden muss, „auch wenn die dahinterliegenden Begriffe und Konzepte überholt sind“. Der Begriff Transidentität wird zwar umgangssprachlich und in Arztbriefen immer wieder verwendet, ist aber keine eigenständige medizinische Diagnose. Erst 2022 werden diese Richtlinien angepasst, sodass der Begriff der Transsexualität dann endgültig daraus verschwindet und durch den Begriff Geschlechtsdysphorie ersetzt wird. Dass die Klassifizierung dem medizinischen Fortschritt hinterherhängt, hat auch historische Gründe.
Lange wurde Transidentität als psychische Krankheit begriffen, weil Patient:innen überdurchschnittlich oft psychopathologische Störungen wie Depressionen, Suchtverhalten oder Suizidalität aufwiesen. Hierbei wurden jedoch Ursache und Wirkung vertauscht, erklärt Professor Romer: „Wenn man diese Menschen in ihrem gefühlten Geschlecht leben lässt und das unterstützt, dann entfalten sie sich psychisch unauffällig.“ Erst das erzwungene Leben in einer als falsch empfundenen Identität oder einem als falsch empfundenen Körper führen also zu den genannten psychopathologischen Auffälligkeiten.
Ein weiteres Problem des Begutachtungsverfahrens: Es gibt keine einheitlichen Standards. Gutachter:innen entscheiden selbst, welche Tests, welche Fragen und welche Methoden sie anwenden. Theresia sitzt an diesem Tag über drei Stunden in der Praxis ihres Gutachters, um neben einem Intelligenztest auch einen – für männliche Patienten konzipierten – Persönlichkeitstest auszufüllen. Anschließend wird sie gefragt, ob sie als kleines Kind mit Puppen gespielt hätte. Berichte über entwürdigende Praktiken und Fragen werden immer wieder laut. So berichtet eine Patientin, sie hätte sich bis auf die Unterwäsche ausziehen und auf einem Bein hüpfen müssen. Ein anderer sei gebeten worden, seine Lebensgeschichte mit Lego-Bausteinen abzubilden. Fragen wie „Können sie sich vorstellen, sexuelle Handlungen an Tieren oder Kindern vorzunehmen?“ oder „Wie oft masturbieren sie wöchentlich – und tragen sie dabei Frauenunterwäsche?“ scheinen bei einigen Gutachter:innen immer noch als geeignete Methode zu gelten, um Transidentität zu diagnostizieren.
„Da muss die Seele mitkommen“
Professor Romer plädiert dafür, zumindest die juristische Transition radikal zu erleichtern. In vielen Ländern sei eine Personenstandsänderung „geregelt wie ein Kirchenaustritt“. Befürchtungen, wonach plötzlich massenhaft Menschen lustig-munter ihr Geschlecht wechseln würden, erwiesen sich als falsch: „Davon ist das Abendland auch nicht untergegangen“. Anders verhält es sich mit der medizinischen Transition. Vor einem operativen Eingriff in einen Körper sollte umfangreich geprüft werden, ob sich die Patient:innen sicher in ihrer Entscheidung sind. „Da habe ich nicht nur das berechtigte Selbstbestimmungsrecht dieser Person vor Augen, sondern auch eine ärztliche, ethische und medizinische Verantwortung.“ In jedem Fall aber sei es wichtig, dem Gegenüber eine respektvolle Haltung entgegenzubringen. Er wolle nicht als Gatekeeper wahrgenommen werden, der auf dem Weg zu einer Operation ein Hindernis darstellt. Aber für ihn steht auch fest: Jeder Eingriff kann psychische Begleiterscheinungen auslösen, weshalb die ausreichende Vorbereitung wichtig ist. „Da muss die Seele mitkommen.“ Seinen Patient:innen gibt er darum den Rat, vor medizinischen Eingriffen die soziale Transition so weit vollzogen zu haben, „dass es im gesamten Umfeld keinen einzigen Menschen mehr gibt, der darauf verwirrt oder überrascht reagiert.
Am Ende hat ihr erster Therapeut nicht Recht behalten: Allen Widrigkeiten zum Trotz ist Theresia den Weg gegangen. Dass ihr das gelungen ist, hat sie auch ihrem Umfeld zu verdanken. Obwohl sie im ländlichen Raum aufgewachsen ist und weite Teile ihrer Familie konservativ sind, akzeptieren sie Theresias Identität – vorbehaltlos. „Ich habe sehr viel Glück mit meinem Umfeld. Die Leute haben oft viel größere Angst vor einem Outing, als es dann tatsächlich schlimm ist.“ Ihre Mutter bringt ihr als Geste der Unterstützung Nagellack vom Einkaufen mit, ihre Großmutter reagiert gelassen auf Theresias Outing: „Ach Gott sei Dank! Ich habe schon gedacht du wärst sterbenskrank!“. Einzig ein entfremdeter Großvater ist noch ahnungslos: „Ich hatte die Abmachung mit meinem Bruder, dass ich als seine Freundin auftrete, wenn wir den treffen.“ Auch auf ihre Freund*innen kann Theresia zählen: Wenn sie auf der Straße transfeindlich angegangen wird, seien die durchaus auch bereit, sich für sie zu prügeln. Doch leider haben längst nicht alle transidenten Menschen so viel Glück.
Ihre Familie flehte sie an, wieder zu Gott zu finden
Wer weiß, vielleicht wäre Julia Monros Lebensweg mit ein bisschen familiärer Unterstützung auch anders verlaufen. Wer die 39-Jährige heute in den sozialen Medien verfolgt, sieht eine gelöste Frau, die fröhlich in die Kamera lächelt. Blonde Haare, blaue Augen, in Arbeit vertieft, in der Straßenbahn, bei einem Fotoshooting oder passend zur Fußball-EM im Deutschlandtrikot mit Regenbogenbinde am rechten Arm. Doch der Weg dorthin war steinig.

Foto: Privat
Julia wächst in einer russlanddeutschen, erzkonservativen Familie auf. Homosexualität oder gar Transsexualität sind zuhause, aber auch in der Kirche, ein Tabu, werden sogar aktiv bekämpft. Julias Outing geschieht 2016 unfreiwillig. Zu der Zeit lebt sie noch in einer heterosexuellen Beziehung, nimmt aber schon Hormone ein. Als sie die Beziehung beendet, outet ihre damalige Freundin sie vor Familie und Freundeskreis, zeichnet das Bild eines psychisch kranken Mannes, der zum Spaß Frauenkleider trägt. In Erklärungsnot geraten muss Julia vor ihrer Familie ihre Transidentität zugeben. Einfach weitermachen wie bisher? „Ob ich als Mann oder als Frau weiterlebe, der Effekt wäre der gleiche. Wozu soll ich mich dann noch verstecken?“ Also räumt sie ihre Klamotten, Relikte aus einem anderen Leben, in den Keller und beginnt, offen als Frau zu leben. Von einem auf den nächsten Tag verliert Julia fast ihr gesamtes soziales Umfeld, verliert ihre Arbeit, wird wie eine Ausgestoßene behandelt. Es folgen nachts zerstochene Autoreifen und ein Bombardement aus Anrufen und Textnachrichten. Ihre Familie fleht sie an, einen Seelsorger aufzusuchen und Buße für ihre „Krankheit“ zu tun, sich von der angeblichen Genderideologie zu befreien. Die extreme Ablehnung hat auch mit dem religiösen Hintergrund ihres Umfeldes zu tun: „Diese Denkweise ist dort anerzogen worden“. Zu ihr stehen, oder wenigstens Akzeptanz zeigen, will niemand. Die Isolation setzt Julia zu. Als sie davon erzählt, kommen ihr die Tränen: „Ich war kurz davor, von einer Brücke zu springen“. Einzig ihre Mutter hält den Kontakt, versucht aber, ihre Tochter zur Umkehr zu bewegen. Zu groß ist der Druck aus der Kirchengemeinde, zu stark die Scham, wenn Nachbarn sie darauf ansprechen, warum ihr Kind sie in Frauenklamotten besucht.
„Du hast das Drama überlebt.“
Julia bricht alle Brücken ab, zieht nach Koblenz. Doch die Vergangenheit folgt ihr: Ein ehemaliger Freund meldet sich per Instagram, spricht sie bewusst mit ihrem alten Namen an, denn das sei schließlich der Name, unter dem er sie kenne. Dass sie sich jetzt Julia nennt, will er nicht akzeptieren. Mittlerweile hat Julia gelernt, mit solchen Anfeindungen umzugehen, blockt den Kontaktversuch ab: „Ich führe diese Debatten seit Ewigkeiten. Warum soll ich mich darüber noch mit jemandem streiten, der meine grundlegende Identität nicht anerkennt?“ Der Wendepunkt kommt im Oktober 2018 bei einem Vortrag, den sie im Koblenzer Schloss halten darf. Eine Freundin organisiert damals die Veranstaltung mit dem Titel FuckUp night. Der Name ist Programm: Gescheiterte Existenzen erzählen von ihrem vermurksten Leben – und wie es danach weiterging. Für die Freundin ist klar: Julias Geschichte ist prädestiniert für so einen Auftritt. Dass fremde Menschen ihr applaudieren, während ihre eigene Familie sie verstoßen hat, löst in Julia viele Emotionen aus – vor allem aber Erleichterung: „Du hast das Drama überlebt.“ Als gescheitert kann man Julias Leben wohl kaum bezeichnen. Aus den düsteren Erfahrungen zieht sie die Kraft für das, was noch kommt. Sie beginnt, als Aktivistin für Trans-Rechte zu kämpfen. Der Auftritt in Koblenz hat ihr gezeigt, dass sie Menschen inspirieren kann, also steckt sie alle Zeit, die sie aufbringen kann, in ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten. Diese verleiht ihr neues Selbstbewusstsein: „Das hat mir gezeigt, dass ich nicht auf dem falschen Weg bin, dass ich auch Menschen helfen kann“.
Mittlerweile arbeitet Julia nicht nur als Pressesprecherin bei der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti), sondern betreut auch ein eigenes soziales Projekt. In ihrer Gruppe transkids können junge Menschen und deren Eltern ihre Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig helfen – etwa beim Thema Therapie, oder wenn die Krankenkasse oder die Schule sich querstellt. Gerade letztere wüssten oft wenig über die gesetzlichen Regelungen, trauten sich beispielsweise aus Angst vor Dokumentenfälschung nicht, Zeugnisse auf einen neuen Namen auszustellen. Die Gruppe ist seit ihrer Gründung stetig angewachsen, aktuell besteht sie aus circa 25 Kindern und ihren Eltern. Dass mehr Kinder schon im jungen Alter den Mut finden, ihre Transidentität auszuleben, liegt auch an der wachsenden Akzeptanz der Gesellschaft und der zunehmenden Repräsentation. „Heute finden die Kids das überall, bei YouTube und TikTok, die sind ja heute aufgeklärter als manch anderer.“ Auch Professor Romer kann einen deutlichen Anstieg an Patient:innen beobachten. Die Zahl habe sich in den letzten acht Jahren beinahe verzehnfacht. Einen Grund zur Sorg sieht er darin aber nicht. Durch die wachsende Akzeptanz und Sichtbarkeit verlagere sich der Selbstfindungsprozess zunehmend bereits ins Kindes- und Jugendalter. „Ich rate zu größter Gelassenheit und Zurückhaltung“.
Der Kampf um Gleichberechtigung ist heute vor allem ein politischer. Die dgti arbeitet neben der umfassenden Beratung von transidenten Menschen daher als Interessensverband, berät und verhandelt mit der Politik – beispielsweise 2020, als der Bundestag ein Verbot von Konversionstherapien auf den Weg bringt. Aus eigener Erfahrung weiß Julia Monro, wie problematisch religiöse Konversionstherapien sind, die oftmals unter dem Deckmantel der Seelsorge arbeiten. Derzeit gilt das Verbot nur für Kinder unter 18 Jahren oder Menschen, die ihre Einwilligung nur durch Zwang oder Täuschung erteilen. Julia wünscht sich ein vollständiges Verbot: „Das wird mir persönlich noch nicht scharf genug sanktioniert“.
Auch Theresia engagiert sich politisch. Sie ist Vorstandsmitglied der Jusos Bayern und deren wirtschafts- und sozialpolitische Sprecherin. Doch anders als Julia hält sie sich bewusst von queerpolitischen Themen fern. Sie will nicht immer nur als Opfer zu Diskussionen geladen sein. Stattdessen sollen Ausbildung und Qualifikationen im Fokus liegen – und die hat sie nun mal im Wirtschaftsbereich. Zu oft, zu lange muss sie schon die ermüdenden Debatten führen, die das eigene Existenzrecht betreffen. „Es ist anstrengend, darüber zu sprechen, wer dich und deine Identität und deine Existenz als solches ablehnt“. Also erteilt sie solchen Einladungen, die sie nur als Betroffene erhält, bewusst Absagen: „Da spreche ich sehr viel lieber über Steuern.“
Ein Gesetz jenseits der Grenze zur Verfassungswidrigkeit
Was müde macht, dürfte vor allem das Gefühl sein, ohne Aussicht auf Erfolg auf der Stelle zu treten. Seit nun mehr vier Jahrzehnten gibt es in Deutschland das Transsexuellengesetz (TSG). Beinahe genauso lang gibt es Forderungen, das TSG abzuschaffen. Nur ein Jahr nach Einführung urteilte das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal, dass ein Artikel des TSG gegen das Grundgesetz verstößt.
Im TSG ist geregelt, welche Voraussetzungen Personen erfüllen müssen, um eine Personenstands- oder Namensänderung zu erwirken. Mehrfach wurde das TSG bereits in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Noch bis 2011 beinhaltete es beispielsweise Zwangssterilisationen als Voraussetzung für Personenstandsänderung oder genitalangleichende Operationen. Das Bundesverfassungsgericht stufte das als mit dem Grundgesetz unvereinbar ein. Seither wird der Passus nicht mehr angewendet. Viele Krankenkassen wissen aber nicht um die Trennung von rechtlicher und medizinischer Transition und genehmigen daher beispielsweise Operationen erst, wenn auch eine Namensänderung erfolgt ist. Auch hier unterstützt die dgti transidente Menschen, etwa dabei, Widerspruch einzulegen oder Aufsichtsbeschwerde zu erheben. „Nach zwei oder drei Wochen ist dann manchmal plötzlich die Genehmigung da“.
Auch für Professor Romer ist der Konflikt mit den Krankenkassen nicht unbekannt. Obwohl die medizinische Fachwelt sich dafür aussprach, strikte Begutachtungsrichtlinien abzuschaffen und stattdessen jeden Fall individuell zu bewerten, erließ der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) erst kürzlich neue Richtlinien, die nach starrem Schema vorschreiben, wann eine Operation als Kassenleistung bewilligt wird. „Das ist Hinterzimmerwillkür“. Die Bundespsychotherapeutenkammer nannte die Richtlinien gar unethisch und mit ihrem Berufsethos unvereinbar. Patient:innen haben die Möglichkeit, gegen ablehnende Bescheide ihrer Krankenkasse zu klagen. Die vom Gericht bestellten Gutachter:innen sind dann selbst nicht an die Richtlinien des MDK gebunden, sodass die Krankenkassen diese Prozesse häufig verlieren. Trotzdem bedeutet der Streit zwischen medizinischer Fachwelt und MDK, dass Patient:innen länger auf medizinische Maßnahmen warten müssen. „Der Streit tobt zulasten der Betroffenen.“ Julia Monro hat durch ihre Arbeit schon Leute kennengelernt, die für eine geschlechtsangleichende Operation ins Ausland gereist sind: „Die hatten einfach keinen Bock, sich mit der Krankenkasse rumzustreiten“.
Aus dem Transsexuellengesetz endlich Geschichte machen
Neben der Medizin werden auch in der Gesellschaft Rufe nach Reformen lauter und lauter. Das TSG steht durch die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes auf wackligen Füßen – und könnte demnächst ersetzt werden. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat bereits einen eigenen Gesetzesentwurf vorgelegt, der das TSG ersetzen soll. Das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz schafft die Gutachtenpflicht ab, stattdessen sollen Personen ab 14 Jahren eigenständig über Namen und Geschlechtseintrag entscheiden dürfen. Behörden dürften dann ohne Zustimmung der betroffenen Person auch keine Informationen über erfolgte Änderungen herausgeben. Sven Lehmann, Mitautor und queerpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, sieht die Abschaffung des TSG als alternativlos an: „An so einem löchrigen Gesetz weiter herumzudoktern, macht keinen Sinn“. Das Selbstbestimmungsgesetz soll dann sowohl für trans- als auch für intersexuelle Menschen gelten, während bislang separate Regelungen im TSG und im Personenstandsgesetz existieren. Aber auch hier gibt es noch Nachbesserungsbedarf, etwa im Arbeitsschutz. Julia Monro würde sich einen Kündigungsschutz analog zum Mutterschutz wünschen. Denn selbst wenn Unternehmen die Transidentität akzeptieren, muss mit hohen Ausfallzeiten gerechnet werden, zum Beispiel wegen Therapien oder Operationen. Firmen wollten aber häufig nicht in „totes Kapital“ investieren, „und am nächsten Morgen liegt die Kündigung auf dem Tisch“.
Im Bundestag wurde das Gesetz Mitte Mai bereits beraten und abgelehnt. Nach eigenen Aussagen will die Union einen gesonderten Entwurf vorlegen. Die Bundespsychotherapeutenkammer sprach sich bereits gegen diesen Entwurf in seiner jetzigen Form, der beispielsweise die Begutachtungspflicht beibehält, aus: Diese sei eine „unzumutbare Hürden für trans- und intergeschlechtliche Menschen“. Julia Monro winkt ab, als sie danach gefragt wird: „Die haben doch gar keinen Bock, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das kratzt an deren christlichem Weltbild“. Stattdessen sei das Papier aus dem Innenministerium heraus Ende Januar an transfeindliche Verbände geleakt worden. Und tatsächlich: Auf der von Verschwörungstheorien und transfeindlichen Äußerungen geprägten Website des Vereins DemoFürAlle, der sich selbst als Bündnis „für Ehe und Familie“ und „gegen Gender-Ideologie und Sexualisierung der Kinder“ betitelt, findet sich eine Pressemitteilung zum Gesetzentwurf eines sogenannten Geschlechtseintragsänderungsgesetzes.
Das Bündnis, dem beispielsweise der Tagesspiegel eine Nähe zu religiösem Fundamentalismus und Neonazis bescheinigt, gibt sich familienfreundlich, verbreitet aber schon seit Jahren antifeministische Hetze gegen Homosexuelle und trans Menschen. Stolz schreibt der Verein, durch die Veröffentlichung des Gesetzentwurf von Innen- und Justizministerium sei man „der Transgender-Lobby“ zuvorgekommen. Der Verein verbreitet das Narrativ einer um sich greifenden „Gender-Ideologie“, eines „Transhypes“, der vornehmlich Mädchen und junge Frauen absichtlich verwirre und zur Verstümmelung des eigenen Körpers treibe. Schuld ist, na klar: Die „Trans-Lobby“. In dieselbe Kerbe schlägt auch die AfD. Beatrix von Storch nannte den Gesetzesentwurf der Grünen in der Bundestagsdebatte „genderpolitischen Wahnsinn“, „irre“ und „ekelhaft“.
Und der Regierungspartner SPD? Findet den Gesetzentwurf der Grünen laut eigenen Aussagen gut, kann aber leider nicht dafür stimmen – der Fraktionszwang steht im Weg. Theresia, selbst Mitglied der Jusos, kann nur müde lächeln, als sie darauf angesprochen wird. „Ich bin nicht überrascht. Diese Partei bringt es einfach nicht zustande, einen Kompromiss zu fassen.“ Julia Monro hingegen ist wütend, schließlich habe man bei der Ehe für Alle trotz Fraktionszwang gegen den Regierungspartner gestimmt. Warum also nicht jetzt auch? Immerhin: Die Verhandlungen mit der Union hat die SPD abgebrochen. So ist zumindest gewährleistet, dass der Entwurf der Union, der beispielsweise die Begutachtungspflicht beibehalten will, nicht noch kurz vor Legislaturende durch den Bundestag bestätigt wird. Die Hoffnung der Transcommunity liegt auf neuen Mehrheiten nach der Bundestagswahl im September. Dann wollen die Grünen das Selbstbestimmungsgesetz ganz nach oben auf die Agenda setzen, versichert Sven Lehmann: „Wir werden alles dafür tun, damit das Transsexuellengesetz endlich Geschichte wird.“
Professor Romer indes wird unabhängig vom Wahlausgang alles daransetzen, seine Patient:innen bestmöglich zu beraten. Das Wichtigste sei es, sie darin zu bestärken, ihre Persönlichkeit frei zu erkunden und zu entfalten. Ohne Druck, ohne Konformität. Affirmativ, aber ergebnisoffen. Er orientiert sich dabei an einem alten Kinderlied von Rolf Zukowski: „So wie du bist, so wie du bist, so und nicht anders sollst du sein.“
Im Podcast: Einmal Transition und zurück? Elis Weg zur Nicht-Binarität
In dieser Geschichte wurden Theresias und Julias Geschichten erzählt. Aber keine zwei Geschichten sind identisch. In meiner Ausgabe unseres Podcasts „Nahaufnahme“ habe ich mich mit Eli unterhalten, die auf ihrem Weg schon mehr als einmal in eine neue Richtung abgebogen ist. Neugierig? Dann hör‘ jetzt rein!
![[Un]nahbar [Un]nahbar](https://wp.zim.uni-passau.de/unnahbar/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/Schriftzug_JMC-2021.png)