„Wir werden auch künftig mit Nachdruck eine umfassende Provenienzforschung in Deutschland vorantreiben. Wie begrüßen, dass das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste seine Ergebnisse zunehmend öffentlich macht.“
Koalitionsvertrag 2018, S. 169
„Am Ethnologischen Museum sowie am Museum für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin gibt es vier feste Provenienzforschungsstellen. Das ist in Deutschland eine Ausnahme, was ethnologische Sammlungen oder nicht europäische Sammlungen angeht.“
Paola Margherita Ivanov Kuratorin der Sammlung Nordost-, Ost-, Zentral- und Südafrika am Ethnologischen Museum.
Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist eine anhaltende Distanz zur Eigenen Kolonialgeschichte
Schwarz/ Schwarze Menschen
Die Begriffe Schwarz oder Schwarze Menschen sind von Rassismusexpert:innen anerkannte Termini. „Der Begriff wird in jedem Kontext mit großem >S< geschrieben. Dadurch soll sichtbar gemacht werden, dass es sich nicht um das Adjektiv >schwarz< handelt und sich somit auch nicht auf die Farbe bezieht, sondern um eine politische Selbstbezeichnung“ (Ogette, 2020, S. 77). Schwarze Menschen machen aufgrund ihrer Hautfarbe und die damit einhergehende Rassifizierung ähnliche Rassismuserfahrungen und lassen sich somit als eine gemeinsame politische Gruppe lesen. „Durch rassistische Diskurse und die darin eingelassenen Wissensbestände werden Schwarze Menschen in Deutschland bis heute in bestimmter Weise positioniert, […] sie [werden] aufgrund ihrer Hautfarbe als besonders sportlich oder besonders musikalisch markiert […]“ (Ransiek, 2019, S. 1). Schwarz mit großem S gilt als Selbstbezeichnung und hebt sich demnach von rassistisch konnotierten Fremdbezeichnungen wie beispielsweise dem Begriff „farbig“ ab. Weitere Begriffe, die als Selbstbezeichnungen gelten sind Beispielsweise die Begriffe PoC (People of Color bzw. Person of Color) und BiPoC (Black and Indigenous People of Color).
„Irgendwann habe ich auch Angst gehabt, dass ich der Verräter bin“, sagt Ngako Keuni. Er sitzt im Schneidersitz auf einer Wiese und schaut mit wachsamen Augen zu dem riesigen Gebäude, dass das Berliner Stadtbild prägt, dem Humboldt Forum. „Wenn ich hier einen Job annehme, wo andere Leute, die so wie ich sind, abgesagt haben. Oder weil ich die Geschichte hinter dem Aufbau des Humboldt Forums kenne“, erzählt der 35-Jährige weiter und legt die Hände nachdenklich an sein Kinn.
Ngako Keuni ist ein Künstler, ein Schwarzer Künstler. Er selbst sieht sich als Performer, der die Bühne und den Film liebt. Sein Weg als Künstler führte ihn von Kamerun nach Katar und schließlich 2016 für sein Studium nach Berlin an die Universität der Künste. Während des Gesprächs verlagert er ständig nervös das Gewicht und ändert seine Sitzposition. Seit kurzem laufen die Proben für die Inszenierung „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – eine Performance für Kinder und Jugendliche, bei der er versucht, seine Perspektive einzubringen

Zunächst wollte Ngako Keuni das Engagement absagen, so wie die Künstler:innen vor ihm, und das tat er auch. Erst nach einem Gespräch mit der Regisseurin ließ er sich zu dem Projekt überreden: „Die Regisseurin meinte: ‚Wenn jetzt alle absagen, wie kommen wir in ein Gespräch? Dann entsteht keine Kommunikation zwischen uns und den anderen.‘“
Ngako Keuni soll eine Brücke sein, eine Schwarze Perspektive im Humboldt Forum, das für seinen Umgang mit der kolonialen Raubgeschichte kritisiert wird. Die Wissenschaftler:innen Felwine Sarr und Bénédicte Savoy kommen in ihrem Bericht 2018Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle zu dem Ergebnis, dass schätzungsweise 90 Prozent des materiellen kulturellen Erbes des subsaharischen Afrikas sich nicht auf dem afrikanischen Kontinent befindet – eine Feststellung, welche die Debatte um mögliche Rückgaben von Sammlungsgut aus kolonialem Kontext neu entfacht hat, auch im Falle des Humboldt Forums.
Eigentlich soll das Mammutprojekt die gesellschaftliche Distanz zur eigenen kolonialen Geschichte aber schließen. Kann das funktionieren?
Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist das „Koloniale Walt Disney von Berlin“
[slideshow_deploy id=’1150′]
Der Platz vor dem Humboldt Forum ist grau gepflastert, auf dem Boden finden sich mit Kreide verfasste Anschuldigungen, die deutliche Ablehnung signalisieren. Es sind Jahreszahlen zu erkennen, einige Wörter sind noch erkennbar: „PLÜNDERUNG = RAUB“. Ein paar Meter weiter, einer der Eingänge zum Hof, der sich mittig zum Forum befindet.
„Kritik ist für ein Forum zentral und wir begrüßen Sie. Vielstimmigkeit und unterschiedlichen Positionen bieten wir Raum, zum Beispiel in unseren Ausstellungen sowie in den zahlreichen Veranstaltungsformaten, mit denen wir bereits begonnen haben und die wir in den kommenden Monaten intensivieren werden. Hier können wir mit Kritik konstruktiv umgehen und mit Kritiker:innen in einen konstruktiven Austausch treten. Dies ist bei Schmierereien nicht möglich, weshalb wir in solchen auch keinen kritischen Beitrag erkennen können. Sie werden entfernt“, heißt es in einem schriftlichen Statement von Seiten der Pressestelle des Humboldt Forums.
Das Forum steht mitten in Berlin. Die Fassade ist über und über mit Verzierungen übersehen: Große und kleine Säulen, aus weißem und gelbem Stein, vergoldete Trompeten, Engel, Kronen, kleine Löwenköpfe, Adler, florale Muster, ein vergoldeter Balkon – für diesen Anblick scheinen weder Kosten noch Mühen gescheut worden zu sein. Zwei junge Besucher laufen in den Hof: „Das schaut ja total alt aus“, kommentiert einer von ihnen. Tatsächlich wirkt das Gebäude alles andere als modern, aber teuer. Der Wiederaufbau des Berliner Schlosses geht auf einen Beschluss des Deutschen Bundestages 2002 und einer Empfehlung der Internationalen Expertenkommission Historische Mitte Berlin zurück. 2008 gewann der italienische Architekt Franco Stello in einem internationalen Wettbewerb um den Wideraufbau des Berliner Schlosses. Das Humboldt Forum ist jedoch keine originale Rekonstruktion des ehemaligen Stadtschlosses, da sich beispielsweise auf der Spree-Seite des Gebäudes eine moderne Betonfassade befindet. Die „Spreeterrassen“ sollen sich als Aufenthaltsort Berlins etablieren. Der gesamte Bau soll allerdings erst 2022 komplett fertiggestellt werden, jedoch wird er schrittweise eröffnet.
Die Kosten für das Bauwerk belaufen sich nach Angaben des Humboldt Forums Stand Juli 2020 auf 644 Millionen Euro, hiervon würden 564 Millionen Euro von öffentlichen Geldern finanziert, die Rekonstruktion der Kuppel belaufe sich auf 19 Millionen Euro, die restlichen 80 Millionen für den Wiederaufbau der Außenfassade würden ausschließlich durch Spenden finanziert.




Fotografin: Sadia Ouro-Gbele
Im Eingangsbereich zum Hof finden sich große Displays, auf denen die Namen der Spender:innen wechselnd einfliegen. Der Hinweis, dass immer noch gespendet werden darf, findet sich auf den diversen Displays und auch im „kostenlosen Berliner Extrablatt“, einer Zeitschrift zum Bau des Humboldt Forums, liegt ein Überweisungsträger für das Spendenkonto.
„Dieses Konzept von kolonialen Sammlungen, überhaupt das Konzept von Ausstellungen und Museen, ist ein durch und durch europäisches. Es ist nicht zufällig in der Blütezeit der Kolonialisierung entstanden“, gibt Tahir Della zu bedenken. Er ist seit Mitte der Achtzigerjahre bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD-Bund e.V.) aktiv und hat eine Fachpromotorenstelle im Berliner Promotorenprogramm inne: „Das so zu romantiseren, ist wie eine Art koloniales Walt Disney in Berlin zu schaffen.“
Er kritisiert das Humboldt Forum und seine Symbolik bereits seit mehreren Jahren. Unter anderem engagierte er sich bei der Initiative No Humboldt 21!. Die Initiative forderte 2013 einen sofortigen Baustopp des Mammutprojektes und bemängelte darüber hinaus den Ort der Ausstellung massiv. Das frühere Berliner Stadtschloss war auch ein Kuriositätenkabinett, in dem nicht westliche Menschen zur Schau gestellt wurden, später während der DDR stand dort der Palast der Republik, heute ist es Ausstellungsort von kolonialen Raubstücken. Raubstücke, bei denen zum Teil bis heute nicht klar ist, woher sie kommen, da die sogenannte ProvenienzforschungHerkunftsforschung noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
Ngako Keuni möchte einen kleinen Teil zur Aufarbeitung der Geschichte beitragen. In dem Stück „Ich sehe was, was du nicht siehst“ soll es genau darum gehen. „Was du siehst, sehe ich nicht. Also wenn du mich lässt, kann ich etwas aus deiner Perspektive anschauen und genau sehen, was du siehst“, sagt der Künstler. Seine Schwarze Perspektive ist wichtig für ihn, da die anderen Beteiligten am Stück eine weiße Perspektive mitbringen. Bei der Performance ist die Beschreibung eines abstrakten Objektes zentral. Das Stück ist Teilf der Eröffnung der Werkräume gefördert durch die Humboldt Forum Stiftung. „Es geht bei dem Stück um die Beschreibung eines Objektes. Es geht hier nicht um eine richtige oder falsche Meinung. Wenn ein Kind ein Raumschiff sieht, dann ist das voll okay. Wenn jemand anderes einen Hut sieht, dann ist das auch okay. Jeder soll seine Perspektive einbringen können“, sagt Ngako Keuni.
Das Skript entsteht in gemeinsamer Absprache zwischen der Regisseurin und den Kunstschaffenden. In einer idealen Welt wünscht sich Ngako Keuni, dass seine Hautfarbe keine Rolle mehr spielt, doch der 35-Jährige bleibt realistisch: „Ich glaube, das wäre perfekt, aber das wäre surreal. Das ist nicht die Realität, vor allem wenn man die Geschichte kennt.“
Ngako Keuni ist hier beispielhaft für viele Schwarze Menschen in Deutschland die Alltagsrassismus erleben. Im Podcast Nahaufnahme erzählt Pia Ihedioha, eine der Herausgeber:innen des Magazin Of Colors, von ihren Erfahrungen und wie diese sie prägen.
Nahaufnahme: Schwarze Identitäten in Deutschland
Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ein koloniales Gewaltverbrechen
Paola Margherita Ivanov gerät ins Schwärmen, wenn sie über eines ihrer Lieblingsstücke spricht. Es ist eine Trommel der Sammlung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin. Die Trommel sei wohl im Kontext eines Krieges der Deutschen gegen die Bewohner:innen aus einem Küstenort des heutigen Tansania zwischen 1888 und 1889 erbeutet worden. Was für die Deutschen wohl eine Kriegstrophäe war, hatte für die sogenannte Herkunftsgesellschaft eine sehr viel größere Bedeutung.

„Das ist die Trommel, die für alle Einsetzungsrituale und Lebenszyklusrituale der vielen Herrscher dort notwendig war. In dem man sie wegnimmt, nimmt man auch eine Grundlage der Herrschaft weg“, betont Ivanov, Kuratorin der Sammlung Nordost-, Ost-, Zentral- und Südafrika am Ethnologischen Museum.
Die Trommel aus ihren Erzählungen gehört zu den „ngoma kuu“ Kiswahili für große Trommel . Das 37,5 Kilo schwere Artefakt ist mit Verzierungen versehen und enthält arabische Schriftzeichen, die auf die Besitzenden hinweist. Die Trommel ist also kein bloßes Instrument, sondern gehörte zum „jumbe“, eine Bezeichnung für einen hochrangigen Küstenbewohner. Die Trommel wurde bei Festen, Übergangsriten, bei Trauerfeiern und nur in Anwesenheit des jumbe gespielt. Sklaven und Nicht-Bürgern war es verboten, die ngoma kuu zu spielen. Sie war genauso respektvoll zu behandeln wie der jumbe selbst – sie zu rauben, war wohl eine Machtdemonstration der deutschen Besatzungstruppen. Paola Ivanov schließt ihre Geschichte mit einem Seufzen und betont erneut die Schönheit des Stückes: „Schade, dass sie hier ist.“ Sie meint damit: in Deutschland.
Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Neokolonialsierung
Die europäischen Kolonialmächte raubten in ihrer Sammlungswut alle möglichen Gegenstände: Statuen, religiöse Objekte, zeremonielles Sammlungsgut, Alltagsgegenstände, Grabbeigaben und sogar menschliche Überreste.
Der Leitfaden des Deutschen Museumsbundes zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialem Kontext gibt zu bedenken, dass Porträtierte beispielsweise für Abformungen auch entwürdigende Praktiken erdulden mussten wie zum Beispiel das Entblößen des Kopfes oder des Körpers. Viele der erhobenen Daten wurden genutzt, um das rassistische Weltbild einer sogenannten Rassenideologie zu untermauern. Das Problem sei jedoch der Kontext, in dem all dies von den Europäer:innen angeeignet wurde. Ivanov erklärt klar: „In der breiten Öffentlichkeit wird sehr stark auf den Erwerbungskontext geschaut und weniger, dass wir uns in einem grundsätzlichen Unrechtskontext befinden und zwar der kolonialen Eroberung.“
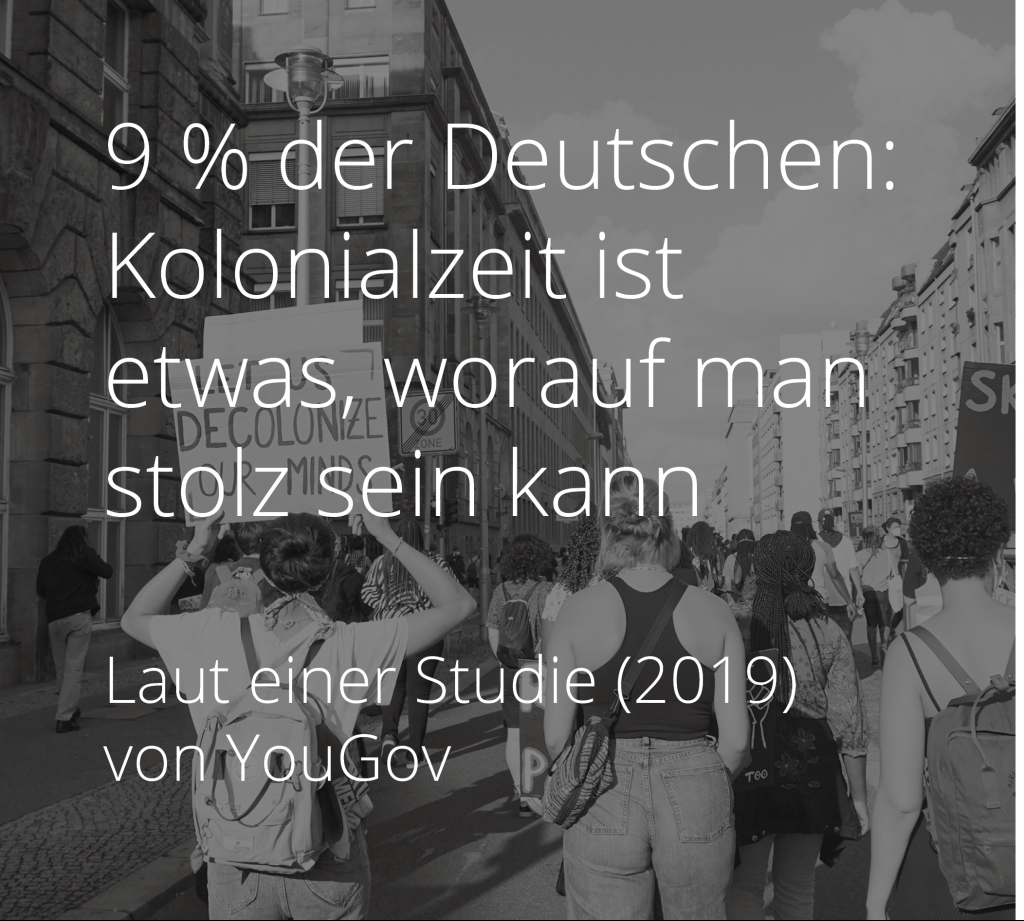
Ein zentraler Bestandteil ihrer Forschung für das Ethnologische Museum ist die Erforschung der Objekte in den Depots. Teil ihrer Arbeit sei somit auch die Rekonstruktion der Geschichte der Objekte: „Der meines Erachtens nach wichtigste Schritt wäre dann eben, mit Herkunftsgesellschaften zu sprechen, also mit Vertreter:innen der verschiedenen Communitys, und wirklich zu schauen, was sie mit diesen Objekten machen wollen, was für eine Bedeutung diese Objekte für sie haben“, fügt sie hinzu. Doch dieses Vorgehen braucht vor allem Zeit und natürlich Geld – am Ethnologischen Museum und am Museum für Asiatische Kunst gibt es aktuell vier feste Provenienzforschungsstellen, die Förderung ist stets nur projektgebunden. Für die Ausstellungen im Humboldtforum bedeutet dies auch, dass nicht alle Ausstellungsstücke erforscht sind. Unter den Exponaten könnte sich also auch sogenanntes sensibles Sammlungsgut befinden, welches nicht präzise eingeordnet werden kann.
Auch Deutschland war an kolonialen Verbrechen beteiligt, auch Deutschland war eine Kolonialmacht. Die deutschen Truppen stiegen auf Schiffe, bereisten die Welt, handelten, versklavten Menschen und beraubten Völker. Trotz des durch und durch gewaltvollen Kontextes kam eine Umfrage aus dem Jahr 2019 zu einem überraschenden Ergebnis: Auf die Frage, ob man stolz auf die die Kolonialzeit sein könnte, stimmten neun Prozent der Deutschen zu, 20 Prozent meinten dagegen, man müsse sich schämen. 40 Prozent der Befragten gaben an, man müsse sich weder schämen, noch könne man darauf stolz sein, 31 Prozent gaben an, es nicht zu wissen.
Die formale Beendigung der deutschen Kolonialherrschaft ist mit Unterzeichnen des Versailler Friedensvertrag 102 Jahre her. Doch allein mit dem Vertrag war der koloniale Einfluss selbstverständlich nicht verschwunden, da beispielsweise koloniale Wirtschaftsbeziehungen anhielten. Für Tahir Della hängt das begrenzte Rassismusverständnis untrennbar mit dem mangelnden Wissen über die Kolonialzeit zusammen. Er fordert daher auch ein besseres Verständnis von den Wirksamkeiten und Kontinuitäten der Kolonialzeit. „Dass so eine Distanz entstanden ist oder immer noch besteht, die gilt es abzubauen. Also deutlich zu machen, wir müssen da viel näher ran. Und damit wächst auch das Problembewusstsein. Das ist einfach nicht vorhanden.“ Er bezeichnet die globalen Verhältnisse als durch und durch kolonial, das zeige sich auch am Humboldt Forum: „Diejenigen Staaten, die kolonialisiert haben, haben in diesem Zug in riesiger Stückzahl Kulturgut geraubt und nach Europa verfrachtet. Dass diese Gesellschaften jetzt über den Prozess bestimmen wollen, wie damit umzugehen ist, also die Deutungshoheit behalten wollen, wie dieser Prozess auszusehen hat, welche Objekte überhaupt rechtmäßig hier sind oder nicht – das alles ist Teil einer Neokolonialisierung.“
Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ein Versuch der Aufarbeitung
Ngako Keuni freut sich über die Gelegenheit, performen zu dürfen und versucht trotz seiner Bedenken, die Performance als Chance zu sehen. Mittlerweile steht er vor dem Humboldt Forum und starrt gegen den Eingang.
„Das erste Mal, als ich da war in dem Gebäude, dachte ich mir schon: ‚Es fühlt sich so… komisch an hier zu sein, also ganz besonders.‘ Dann habe ich mir gesagt, dass ich es trotzdem machen möchte und das Geld spende.“ Er steht vor dem riesigen Gebäude und soll für ein Foto lachen, doch er schaut ständig, ob ihn jemand beobachtet. Vor dem Humboldt Forum zu posieren, und sei es nur für ein Symbolbild, bezeichnet er als bizarr.

Das Humboldt Forum unternimmt Versuche, um Nähe zu den Besuchern, der Geschichte und der Raubkunst zu schaffen. Ob das gelingt, bleibt aufgrund der anhaltenden Kritik fraglich.
Della bleibt dennoch zuversichtlich, dass das Thema noch angemessen behandelt werden wird. Mut schöpft er ausgerechnet beim Rassismusdiskurs: „Über die eigene koloniale Vergangenheit und Rassismus zu sprechen ist nie angenehm, aber führt zu einem besseren Selbstverständnis. Vor 35 Jahren wurde man in Deutschland noch mit großen Fragezeichen angeschaut, wenn über Rassismus gesprochen wurde. Das ist heute anders. Da hat sich schon einiges bewegt.“
Weiterführende Quellen:
- Brössler, SZ: Deutschland erkennt Verbrechen an Herero und Nama als Völkermord an. 28.05.2021. https://www.sueddeutsche.de/politik/kolonialismus-namibia-deutschland-aussoehnung-1.5306378, Zugriff am 28.05.2021.
- Deutscher Museumsbund e.V.: Leitfaden Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. o.a. 02. 2021. https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/03/mb-leitfanden-web-210228-02.pdf, Zugriff am 19.05.2021.
- Hilt, planet wissen: Deutsche Geschichte. Deutsche Kolonien. 09.04.2020. https://www.planetwissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/deutsche_kolonien/index.html, Zugriff am 19.05.2021.
- Ogette, Tupoka (2020). exitRACISM. rassismuskritisch denken lernen. Münster: UNRAST-Verlag.
- Ransiek, A. (2018). Rassismus in Deutschland. Eine macht-reflexive, biographietheoretische und diskursanalytische Studie. Wiesbaden: Springer VS.
![[Un]nahbar [Un]nahbar](https://wp.zim.uni-passau.de/unnahbar/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/Schriftzug_JMC-2021.png)

