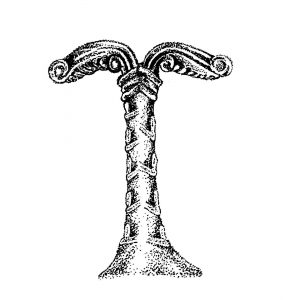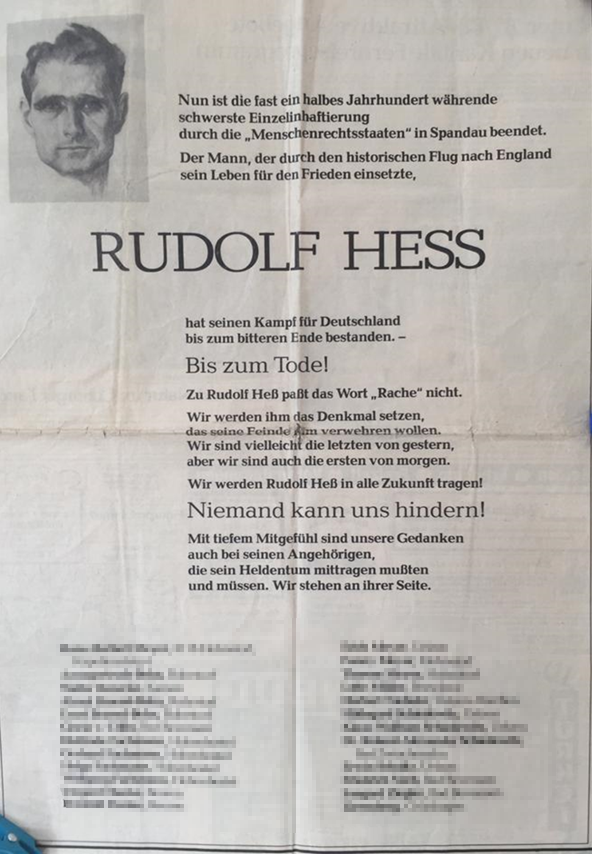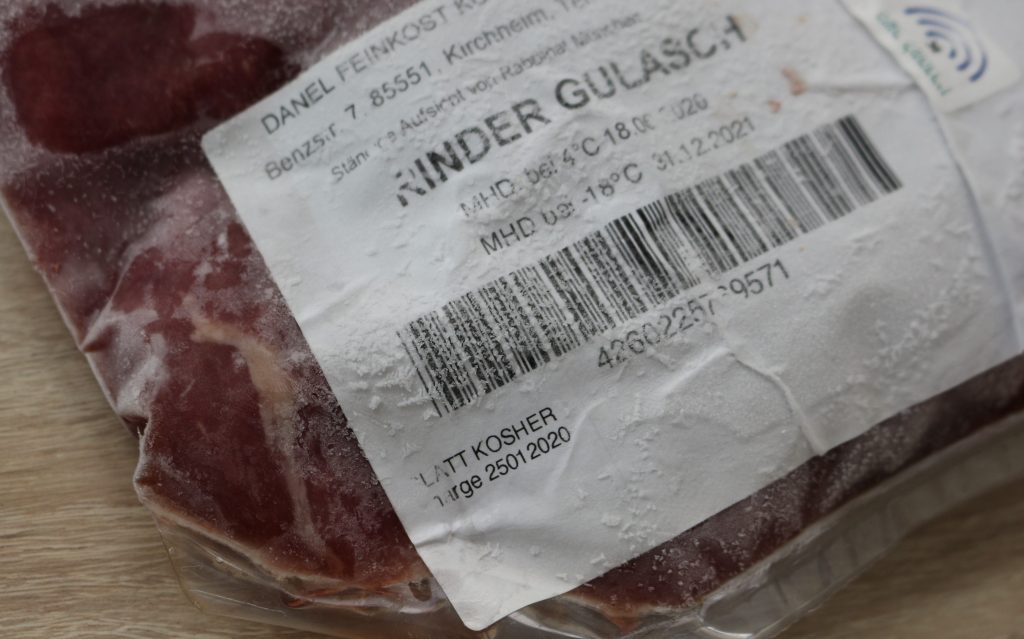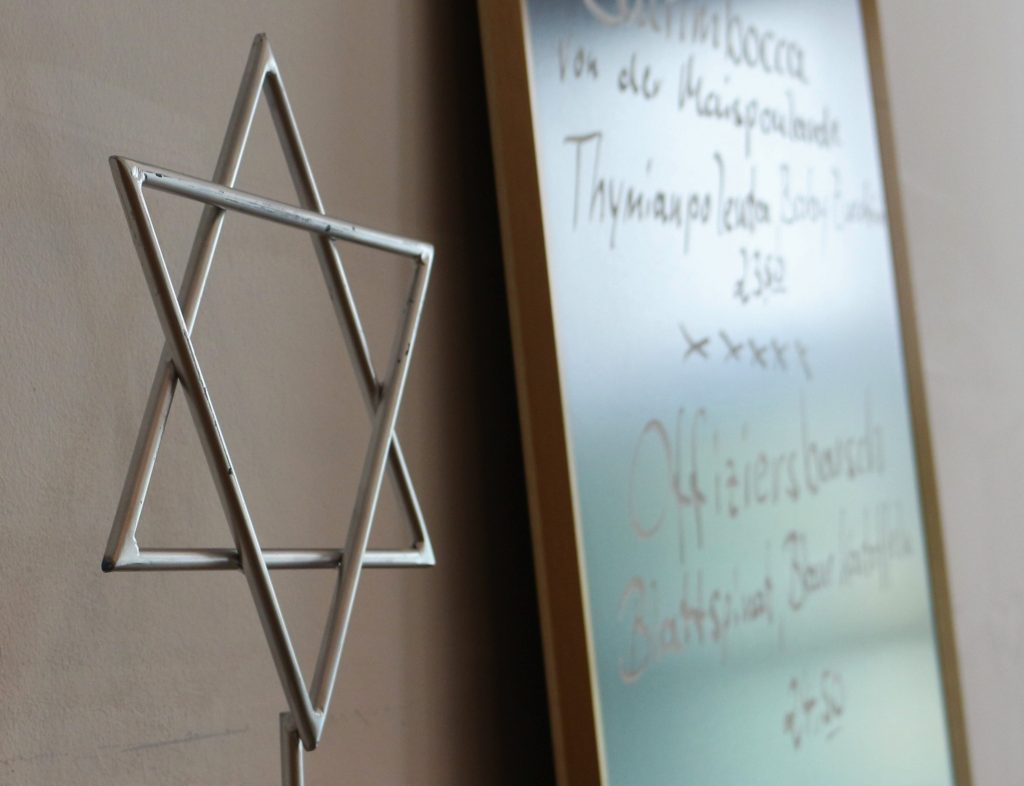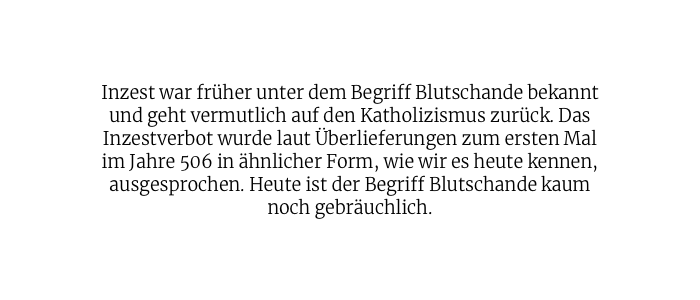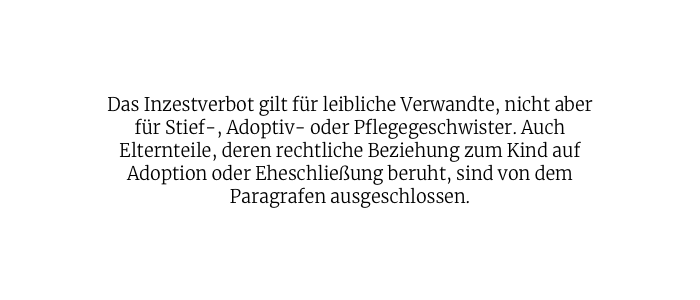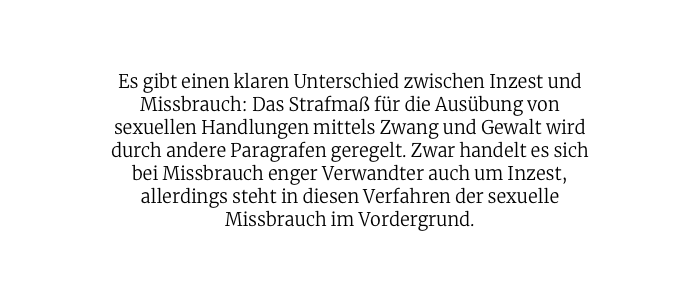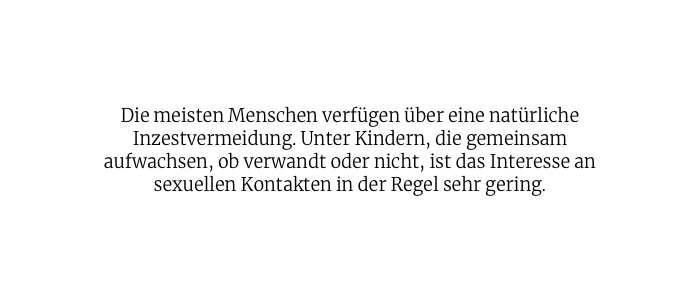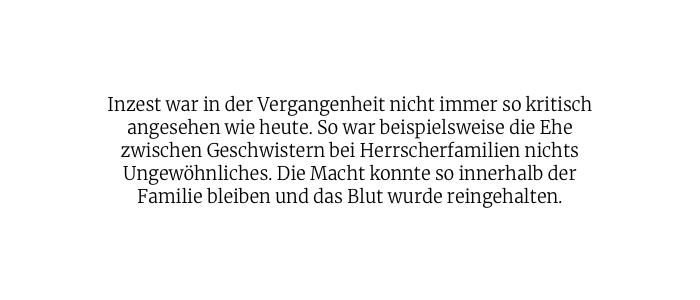Insgesamt über sechs Jahre hat eine Frau* ihre Tage. Ohne sie wäre neues Leben gar nicht möglich und dennoch war und ist die Menstruation stets ein Tabuthema. Nicht mal Frau* selbst kann in vielen Fällen offen darüber sprechen. Wie die Aufklärung zum Thema Menstruation neben den eigenen Eltern und Lehrern noch vollzogen werden kann, zeigt eine Sozialpädagogin mit ihrer Arbeit.
Ein Vorraum einer Turnhalle. Reihum verstreut warten 17 Mädchen* eines Gymnasiums in München. Sie zappeln hin und her, tauschen sich aus und wirken gespannt. Sie sind Schülerinnen* einer fünften Klasse. Ihre männlichen Mitschüler* wurden bereits abgeholt. Bevor es auch für die Mädchen* los geht, müssen sie noch eingeteilt werden. Sie dürfen selbst entscheiden, in welcher Gruppe sie dabei sein wollen. Die erste Gruppe geht mit Danii Arendt mit, die zweite mit Zsuzsa Sandor. Die beiden sind Sozialpädagoginnen und arbeiten für das amanda Projekt.
Bei der amanda Mädchen*- und Frauen*arbeit werden Seminare zu verschiedenen Themen der Aufklärung gehalten. Vorrangige Aufgabe ist es hier, mit den Mädchen* ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen. So sollen die unterschiedlichen Wege aufgezeigt und den Teilnehmerinnen* bewusst werden, dass es nicht nur den einen Lebensweg gibt.
Zsuzsa wird im folgenden mit ihrem Vornamen erwähnt, da sie so auch von den Schülerinnen* angesprochen wird.
Heute sind sie und ihre Kollegin Danii Arendt am Gymnasium in München zu Besuch, um den Mädchen* Themen der Sexualpädagogik näher zu bringen. Ihre Arbeit ist relevant, weil die Aufklärung zuhause oft lückenhaft und nicht ausreichend an die Bedürfnisse von Heranwachsenden angepasst ist.
Aus einer Studie von 2015 zum Thema „Jugendsexualität“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht hervor, dass die häusliche Aufklärung im Jahr 2014 einen Abwärtstrend verzeichnet. Abgelöst wird diese Rolle beispielsweise von Schule und Internet. Jedoch wird zudem deutlich, dass die Aufklärung durch die eigenen Eltern immer noch als relevant zu beurteilen ist und dass Mütter und Väter somit weiterhin als wichtige Vertrauenspersonen fungieren.
Zsuzsa nimmt neun der Mädchen* mit in die erste der verfügbaren Turnhallen. Sie zieht einen Rollrucksack hinter sich her und weist den Schülerinnen* den Weg.
Seit über zehn Jahren arbeitet sie bei amanda.
„Der Wunsch auf dem Gebiet der Frauen*- und Mädchen*arbeit zu arbeiten, kam aus meiner persönlichen Geschichte. Die ständige Benachteiligung, die ich als Mädchen und junge Frau erfahren habe, brachte mich dazu, dass ich unbedingt für Mädchen* und junge Frauen* da sein wollte, die Unterstützung auf ihrem Weg für ein selbstbestimmtes Leben brauchen“, erzählt sie im Gespräch.
Jedes Mädchen* sucht sich einen Platz auf einer Turnbank. Zwischen ihnen genügend Raum, weil die Corona-Hygiene-Bestimmungen das so verlangen. Mit amanda hatten die Schülerinnen* wohl schon einmal zu tun. Und auch wirkt es so, als wüssten sie ganz genau, worum es heute gehen soll. Auf eine Nachfrage dazu grinsen sie, es antwortet jedoch keins der Mädchen*. Bevor es eine Vorstellungsrunde gibt, erzählt Zsuzsa den jungen Frauen* noch von einer Schweigepflicht, sie erklärt, was das genau bedeutet.
Außerdem ist es ihr wichtig, dass die Mädchen* wissen, dass sie immer fragen können. Und dass auch vermeintliche Tabuwörter ausgesprochen werden dürfen: „In vielen Elternhäusern wird immer noch nicht ausführlich über Menstruation gesprochen. Die Mädchen* verbinden letztendlich immer Schmerzen damit oder, dass Blut und Ausflüsse ekelhaft sind. Wir müssen schon sehr dran arbeiten, dass wir gegen diese Vorurteile ankommen können.“
Und das muss natürlich auch nicht vor allen öffentlich passieren. Auch außerhalb der Gruppe, in Pausen oder nach dem Seminar sind sie stets für Fragen bereit.
Auf ihrer Agenda stehen also immer die Bedürfnisse der Schülerinnen*, die möglichen Ängste und auf die Fragen der Mädchen* Antworten zu haben. „Uns ist es wichtig, dass nicht nur die biologische Sexualpädagogik stattfindet, sondern auch andere Aspekte besprochen werden“, sagt sie weiter.
Dominik Kling, ebenfalls Kollege von Zsuzsa und Danii Arendt, arbeitet für die Jungenarbeit goja, sozusagen das Pendant zu amanda. Auch bei ihrer Arbeit spielt das Thema des weiblichen Zyklus und der Menstruation eine bedeutende Rolle. Die beiden Projekte kooperieren zusammen. Wenn sie also an Schulen zu Besuch sind, dann gemeinsam, aber in den meisten Fällen getrennt voneinander.
Für ihn ist es wichtig, dass Eltern Themen dieser Art überhaupt zur Sprache bringen: „Ich glaube, dass Eltern das Angebot leisten müssen zu sagen: Okay, ich bin potentieller Ansprechpartner. Also, dass sie signalisieren: Hey ich bin für dich da, ich erklär’ dir das so gut ich kann“. Wenn sie es nämlich nicht thematisieren, fragen sich Jugendliche, ob sie diese Themen selbst auch verheimlichen müssen, sagt er.
„Ich glaube es ist wichtig, dass Eltern signalisieren: Hey, ich bin für dich da, ich erklär‘ dir das so gut ich kann.“
Dominik Kling
Um ihr Programm heute zu eröffnen, beginnt Zsuzsa mit dem Thema Pubertät.
Sie versucht die Schülerinnen* auf eine Art zu leiten, sodass sie selbst auf die Antworten kommen. Die Mädchen* sind schüchtern. Aber das ist bei diesem Thema normal: „Erstmal sind die Mädels* sehr gschamig, also eher sehr schweigsam und sie finden es irgendwie komisch, dass da jetzt diese Frau da ist und über irgendwelche Tabu- und Schamthemen redet.“
Dominik Kling erklärt den möglichen Grund für das Verhalten der Schüler: „Wir haben oftmals eine Schambehaftung beim Thema Sexualität und allem, was mit weiblicher Sexualität zu tun hat. Es fängt damit an, dass ein Junge* seinen Penis sieht, und ein Mädchen* die Scheide aber nicht. Das wird in einer Form beschämt, als dass es nichts im Alltag zu suchen hätte, dass es keinen Platz dafür gäbe.“
Nach und nach schaffen es dennoch ein paar Stichworte und Einfälle zum Thema Pubertät auf Moderationskarten in die Mitte des Turnbankkreises. „Man bekommt seine Tage“, hilft Zsuzsa nach einer Weile. „Welche Wörter kennt ihr noch?“, wirft sie dann in den Raum. Begriffe wie Menstruation, Periode, Tante Rosa oder Erdbeerwoche sammeln sie und die jungen Frauen* gemeinsam. Der Begriff „Regel“ ist eher unbekannt.
Aus einer Studie der BZgA aus dem Jahr 2006 wird ersichtlich, dass der Prozentsatz derjenigen Mädchen*, die ihre Menarche mit 11-12 Jahren erfahren haben, weiter angestiegen ist.
Aus einer Studie der BZgA wird ersichtlich, dass der Prozentsatz derjenigen Mädchen*, die ihre Menarche mit 11-12 Jahren erfahren, weiter angestiegen ist.
Zudem ist mit Verweis auf die Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys von 2007 zu sagen, dass es ethische Unterschiede in Bezug auf den Einsatz der ersten Regelblutung gibt. So haben beispielsweise türkische Mädchen* der zweiten und dritten Generation, die in den Niederlanden oder Deutschland leben, früher als einheimische Mädchen* ihre Menarche.
Der Körper verändert sich, weil er sich über viele Jahre auf eine Schwangerschaft vorbereitet.
Bei dem Thema Schwangerschaft und Babys werden die Schülerinnen* plötzlich interessierter. Ein Mädchen* mit hellbraunem Haar und einer Brille mit dünnem Metallrahmen, das links von Zsuzsa sitzt, bekommt große Augen.
„Woher kommt denn das Blut?“, fragt Zsuzsa weiter. Im nächsten Moment zückt sie das Paomi einer Gebärmutter.

Paomis heißen ausgesprochen „part of mine“. Sie sehen aus und fühlen sich an wie Stofftiere. Aber in Form von Körperteilen. Sie dienen damit zur Veranschaulichung und Erklärung von Eigenschaften und Abläufen des menschlichen Körpers.
Zsuzsa hält es in der Luft vor ihren Unterbauch, um zu zeigen, wo sich das Organ im Menschen befindet. Daraufhin werden die weiblichen äußeren Geschlechtsorgane ausführlich erklärt. Auch hier hat Zsuzsa passende Paomis dabei. Normalerweise liegen die im roten Zimmer. Dort finden für gewöhnlich die Projekte zum Thema statt. Weil das rote Zimmer wesentlich kleiner als eine Schulturnhalle ist, und ein Sicherheitsabstand zueinander dort nicht gewährleistet werden kann, ziehen Zsuzsa und ihre Kollegin Danii Arendt nun vorerst mobil mit ihrem roten Zimmer von Schule zu Schule und halten ihre Projekte vor Ort.
Im vergangenen Jahr besuchten rund 324 Mädchen* in insgesamt 27 Seminaren die Ausstellung des roten Zimmers. Ursprünglich diente das Zimmer nur zu besonderen Anlässen, wie dem internationalen Frauentag. Weil das Interesse immer weiter gestiegen ist, wurde die Ausstellung durch die Einrichtung eines gesamten Zimmers auch anderen Gruppen, wie beispielsweise Schulklassen, zugänglich gemacht.

Dann stellt sich Zsuzsa in die Mitte und schüttelt ein leichtes, orangefarbenes Tuch und lässt es wie eine Decke auf den Boden sinken. Auf diesem beginnt sie, mit dem Paomi der Gebärmutter und weiteren Tüchern ein Bild zu legen. „Ohne Schleimhäute könnten wir eigentlich so gut wie nichts tun. Beispielsweise nicht sprechen oder schlucken. Und auch in der Gebärmutter haben wir eine Schleimhaut“, erklärt sie. Weil sich die im Zuge eines Zyklus immer weiter aufbaut, um eine eingenistete Eizelle und somit das Baby zu schützen, muss sich diese auch wieder abbauen, wenn es zu keiner Schwangerschaft kommt. Die Mädchen* verstehen, was Zsuzsa meint. „Sie wird also aufgebaut und muss wieder abgeblutet werden“, hierfür platziert sie ein rotes Tuch in der Mitte der Paomi-Gebärmutter. Dass es blutet und schmerzt, weil sich die Gebärmutter zusammenzieht, um die Schleimhaut zu lösen und dabei Äderchen verletzt werden, macht für die Schülerinnen* greifbar, wie der Körper funktioniert. Erstaunte Blicke sind im Raum zu finden. Ein blondes Mädchen* beispielsweise formt ihre Lippen zu einem O. Ihre Augen werden groß, als sie versteht, was im Körper vor sich geht. Danach wird noch ausführlich über den Prozess des Schwangerwerdens und Gefühle gesprochen, die man in einem Zyklus spüren kann.
„Mein Ziel ist es, dass die Mädchen* ihren eigenen Körper und den Zyklus besser kennenlernen und ihre Wünsche, Bedürfnisse und Erfahrungen wahr- und ernstnehmen. Somit sollen sie in verschiedenen Situationen in der Lage sein, die eigene Meinung zu vertreten und auch spontan „nein“ sagen zu können.“
Im Anschluss daran holt Zsuzsa eine Tasche hervor. Auf einem weiteren Tuch breitet sie sämtliche Hygieneprodukte aus. Nach und nach finden einige Tampons, Binden, Slipeinlagen, Menstruationsunterwäsche und -tassen ihren Platz auf dem Tuch. Als Zsuzsa alles ausgebreitet hat, fragt sie: „Was benutzt man, wenn man seine Tage hat?“. Die Schülerin* mit den hellbraunen Haaren und der Brille mit Metallgestell meldet sich und weiß, dass es beispielsweise Binden gibt. Den Rest der Produkte stellt Zsuzsa den Mädchen* vor. Danach zeigt sie, wie sie zu benutzen sind. Dafür führt sie als erstes einen Tampon in die Scheide des Paomis ein. Aus der rechten Ecke hört man ein „Ah“ von einem der Mädchen*. Da die Menstruationstassen um einiges größer sind, zeigt Zsuzsa auch hier, dass man sie zusammenfalten muss und trotz der Größe gut im Körper Platz finden und nicht wehtun. Das Mädchen* mit der Brille kann sich das kaum vorstellen: „Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor den Tassen, ich fange mit der Binde an und warte dann, ob das gut funktioniert.“
Dann meldet sich ein weiteres Mädchen*, sie hat dunkelbraunes langes Haar, dunkle Augen und auf den Lippen ein Lächeln: „Was macht man, wenn man das erste Mal seine Tage bekommt, aufs Klo gehen muss und der Lehrer „nein“ sagt?“
Darauf antwortet Zsuzsa: „Dann sagt man es einfach!“. Und einige der Mädchen* nicken zustimmend.
Zu der Reaktion von Schulen kann Zsuzsa erzählen: „Die Schulen sind uns sehr dankbar, dass wir die Themen, die im Lehrplan stehen, mit den Mädchen* bearbeiten und vertiefen. Es gibt Schulen, die sich traditionell jedes Jahr bei uns melden und wir hören immer wieder, dass unsere Arbeit von zufriedenen Mädchen*beauftragten, Lehrkräften oder der Schulsozialarbeit weiterempfohlen wird.“
„Die Schulen sind uns sehr dankbar, dass wir die Themen, die im Lehrplan stehen, mit den Mädchen* bearbeiten und vertiefen.“
Zsuzsa Sandor
Mehtap Mosavi ist Biologielehrerin am Gymnasium in München und sie sieht die Einladung von externen Referenten als Ergänzung zum Unterrichtsstoff an: „Sie sind eine große Unterstützung, können den Unterricht aber nicht ersetzen.“ Nach ihren Erfahrungen trauen sich die Schüler*innen Fragen zu stellen, wenn es sich nicht um die Lehrer*innen handelt.
Dass es nicht so einfach für die Mädchen* sein kann, sich an Lehrer zu wenden, fällt auf den ersten Blick möglicherweise nicht auf.
Dominik Kling hat folgende Erklärung: „Wenn ich weiß, dass das mein Biolehrer ist, der mich auch bewertet, stell ich dann Fragen? Den sehe ich jeden Tag. Wir Sozialpädagogen sind vielleicht zwei Stunden oder mal einen ganzen Tag lange vor Ort und dann kommen wir nie wieder.“ Zudem müssen Lehrer seiner Meinung nach speziell geschult sein, nicht aufgrund der Informationen, aber aufgrund der Menge an umzusetzenden Lerninhalten und der Schambehaftung des Themas: „Die Lehrkraft muss ja die eigene Scham überwinden, um die Themen dann schamfrei den Jugendlichen vermitteln zu können.“
„Ich habe mich nie geschämt das Thema so sachlich zu unterrichten, wie der Lehrplan es fordert. Es werden auch immer wieder Fortbildungen zum Thema Familien- und Sexualerziehung angeboten, die wir Lehrer besuchen können“, erklärt Mehtap Mosavi. Zudem empfindet sie nicht, dass die Gesellschaft das Thema der Menstruation tabuisiert und führt hier die Umsetzung in Werbungen an.
„Ich denke nicht, dass die Gesellschaft das Thema Menstruation tabuisiert, dies sieht man beispielsweise an der Werbung.“
Mehtap Mosavi
Abschließend sammelt Zsuzsa mit den jungen Frauen* noch Ideen zur Linderung bei aufkommenden Schmerzen. Tanzen, ein warmes Bad, eine kuschelige Decke oder auch die Apotheke und den Kinder- oder Frauenarzt sprechen sie an.
„Ich hab es echt gut verstanden, jetzt weiß ich endlich mal, wie das genau funktioniert. Ist ja echt krass, wie das alles geht“, sagt eines der Mädchen*.
Das Projekt des roten Zimmers trägt für die amandas Früchte: „Die Rückmeldungen sind überwiegend positiv. Oft bedanken sich die Mädchen* bei uns, loben unsere Erklärweise, das Material und finden unsere Räumlichkeiten sehr gemütlich und schön.“
Für Zsuzsa könnte neben dem Umgang, welchen wir von zuhause aus über das Thema Menstruation mitbekommen, auch die über Werbung vermittelte Einstellung ein Grund für den Tabucharakter sein: „Blaues, statt rotes Blut, Sicherheit und Sauberkeit. So als ob wir sonst nicht sicher und sauber wären, wo auch immer wir sind. Dass das normales Blut ist und wir alle einmal neun Monate in einer Gebärmutter gelebt haben, ich glaube das muss irgendwie in die Köpfe rein.“
Eine Welle an Enttabuisierung bricht auf eine Art auch durch das Praktizieren des freien Menstruierens ein. Frauen verzichten hierbei meistens komplett auf Hygieneprodukte und lernen mit der Zeit ihren Blutfluss zu spüren. Viele von ihnen sehen dies auch als „Period Pride“ an. Flora menstruiert frei und offenbart im Podcast spannende Einblicke dazu.
Weiterführende Links:
https://www.bzga.de/infomaterialien/sexualaufklaerung/sexualaufklaerung/jugendsexualitaet-2015/
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/423/293fQNZFAlEs.pdf?sequence=1&isAllowed=y